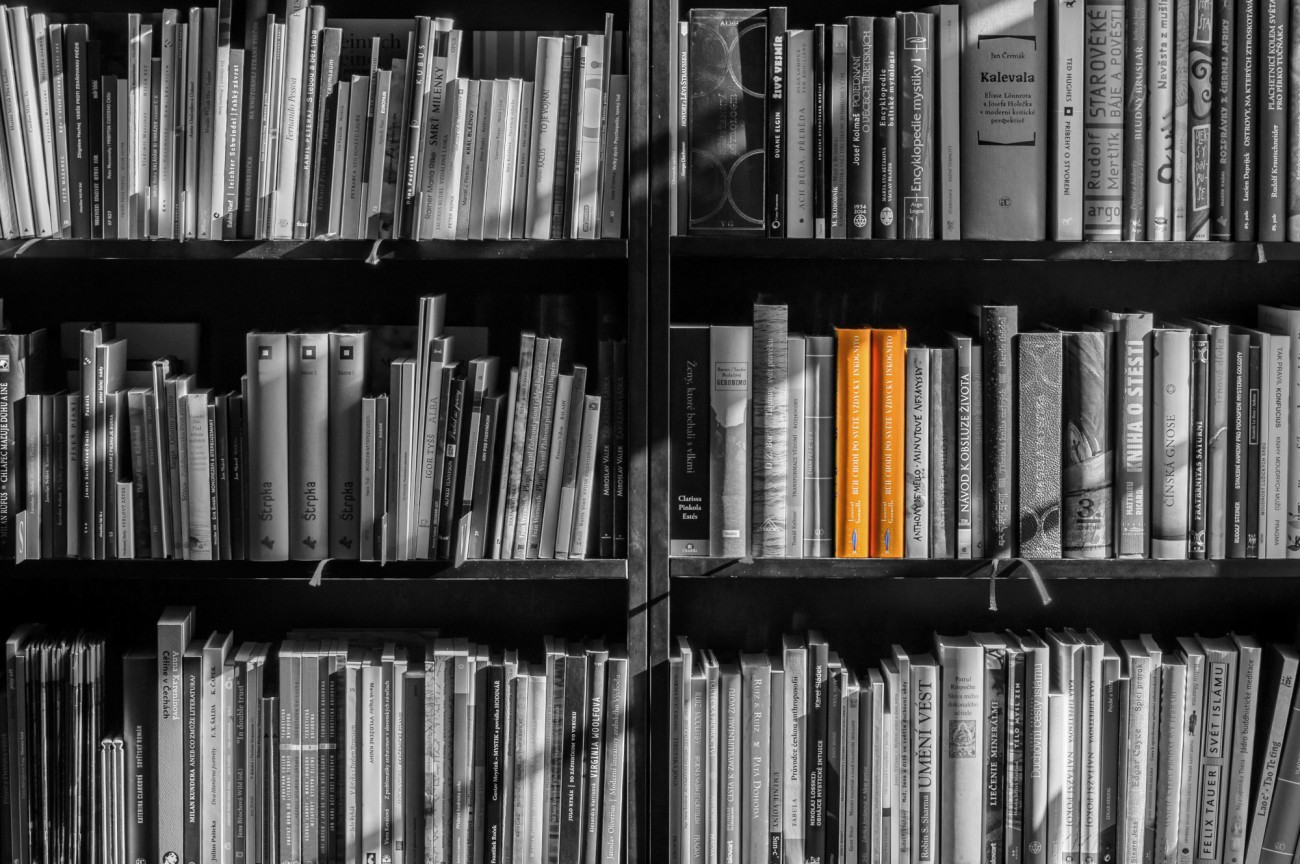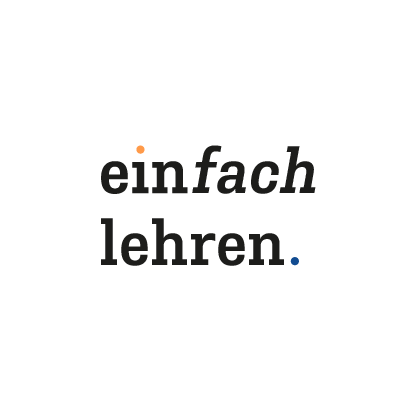Klausurtraining in den Ingenieurwissenschaften
19.11.2025
Mit gezieltem Üben zu besseren Lernergebnissen – auch in Großveranstaltungen.

Was ist die Problematik beim Lernen für Klausuren?
Ihren Studierenden begegnen in der Klausur mehrere Schwierigkeiten. Sie müssen spezifisches Detailwissen abrufen können, komplexe Zusammenhänge verstehen und erläutern und das meist über mehrere Themenbereiche hinweg.
Ein Teil der Studierenden versucht daher beim Lernen die Materialien (Folien, Skripte und Lehrbücher) immer wieder zu lesen, um die Informationen in der Klausur parat zu haben. Diese Art zu lernen ist zeitaufwändig, aber bietet weniger Herausforderungen als andere Arten. Dennoch ist teilweise die Enttäuschung dann groß, weil trotz vielen Lernens durch Lesen man die Formel nun doch wieder nicht wusste.
A common myth about learning is that re-reading is an effective study strategy – but it’s not. Re-reading gives students confidence that they know something when they actually don’t.
Mit dieser Art zu lernen, unterliegen die Lernenden aber der illusion of fluency. Das meint die Illusion, dass, wenn Informationen leicht ins Gehirn gehen – also die Informationsaufnahme leicht vonstattengeht, die Informationen auch gut und lang behalten werden (Agarwal & Bain, 2019). Im Alltag unterliegen wir dieser Illusion regelmäßig. Viele kennen folgende Situation: Man liest wiederholt die Sitzplätze auf dem Ticket für den Zug oder das Flugzeug. Letztendlich weiß man dennoch nicht, wo man sitzen muss, und schaut erneut nach.
Was hilft, damit Lernende Informationen langfristig behalten?
Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Lernende besser korrekt vorhersagen, wenn sie Herausforderungen beim Lernen begegnen (Roediger & Karpicke, 2006). Das lässt sich gut nachvollziehen beim Lernen mit klassischen Karteikarten. Wenn ich erst die gesuchte Formel aufschreiben muss und dann nachschaue, kann ich gut vorhersagen, wie gut ich sie bereits beherrsche. Wenn ich direkt nach der Lösung schaue, kann ich mir einreden, dass ich es eigentlich gewusst hätte. Von einem wirklichen Lernen kann aber nicht die Rede sein.
Wie können Lehrende gewünschte Lern-Herausforderungen schaffen?
Um die notwendigen Herausforderungen für langfristiges Lernen zu schaffen, sind vier Konzepte hilfreich: Retrieval, Spacing, Interleaving, Metacognition (Agarwal, 2025; Agarwal & Bain, 2019; Brown et al., 2014). Was bedeuten sie? Wir bleiben wieder beim exemplarischen Beispiel von Karteikarten und dem Abrufen einer Formel.
Retrieval: Ich muss Wissen tatsächlich selbst aus dem Gedächtnis abrufen und sprechen oder aufschreiben.
Spacing: Ich muss mein Lernen auf verschiedene Zeitpunkte verteilen. Ich kann mir eine Formel besser und langfristiger merken, wenn ich sie alle zwei Tage kurz abrufe, als wenn ich sie die Nacht vor der Prüfung sehr lange am Stück lerne.
Interleaving: Ich kann mir verschiedene Themenbereiche besser langfristig merken, wenn ich sie durchmische. So kann ich mich nicht auf eine bestimmte Reihenfolge verlassen.
Metacognition: Ich muss mich immer wieder selbst überprüfen, also mich selbst kennen, wie gut ich die Formel abrufen kann (Monitoring). Je nachdem, ob ich die Formel tatsächlich parat habe oder auch nicht, muss ich mein nachfolgendes Lernen selbst steuern (Kontrolle). Hierbei entscheide ich mich, dass diese Formel noch öfter im Stapel vorkommen muss, weil ich gemerkt habe, dass ich die Formel noch nicht vollständig korrekt kann.
Lernaufgaben, die diese Aspekte umsetzen, werden in der Literatur Power Tools genannt (Brown et al., 2014). Neben den klassischen Karteikarten sind es auch regelmäßige Quizze und kurze Aufgaben. Hierbei führt Brown aus, warum solche Power Tools funktionieren und dass wir diese Erkenntnisse mit unseren Lernenden teilen sollten: "Power Tools work because, …
- when it comes to learning, you must use it or lose it.
- they provide desirable difficulties, which are good for learning.
- they help you figure out what you know and what you don’t know." (Brown et al., 2014, p. 239)
Wie können Power Tool-Lernaufgaben für ein Klausurtraining eingesetzt werden?
Klausurtraining sollte nicht erst kurz vor der Klausur stattfinden. Ansonsten ist langfristiges Lernen und Behalten nicht möglich. Stattdessen lassen sich regelmäßige Quizze bereits während der Vorlesungszeit einbauen (Prinzipien des Retrievals und Spacings). Beispielhaft wurden für eine große Erstsemesterveranstaltung mit ca. 1.000 Studierenden in der Informatik insgesamt 100 Aufgaben bzw. Fragen erstellt. Hierbei ergeben vier Fragen bzw. Aufgaben jeweils ein Quiz. Beispiele dazu sind auf den folgenden Bildern zu finden. Hier wurden gerade nicht die aktuellen Vorlesungsthemen adressiert, sondern die Themen, die bereits zwei bis vier Wochen zurückliegen. Bezeichnet als das Prinzip des Interleavings. Die Studierenden dürfen jedes Quiz beliebig oft durchführen. So können sie selbst entscheiden, welche Quizze sie bereits gut beherrschen und welche sie nochmals wiederholen möchten (Prinzip der Metacognition).
Zusätzlich wurde den Studierenden noch knapp zwei Wochen vor der Klausur eine viertägige Intensiv-Phase angeboten. Hierzu gibt es kurze Zusammenfassungen der Themen als Input-Vorträge. Die Vorträge werden aber immer wieder mit Live-Abstimmungen sinnvoll unterbrochen. Diese sind den Quizzen ähnlich, jedoch keine Teilmenge der Quizze. Thematisch haben die Live-Abstimmungen vor allem typische Fehler aus bisherigen Klausuren aufgegriffen. Damit decken die live-Abstimmungen drei der vier Aspekte ab, die ein Power Tool ausmachen: Retrieval, Interleaving, Metacognition.
Ein Tag dieser Intensiv-Phase widmet sich dem Live-Klausurrechnen, das von erfahrenen Tutor:innen der Veranstaltung durchgeführt wird. Durch Aufzeichnung dieser Live-Session ergibt sich über die Semester hinweg eine Sammlung, die die Studierenden nutzen können. Voraussetzung für das live-Klausurrechnen ist, dass die Klausuren – im Idealfall mit Lösungen – für die Studierenden zugänglich gemacht werden.
Wie hoch ist der Aufwand für Lehrende und Tutor:innen?
Der größte Personalaufwand liegt nicht in der Durchführung, sondern in der initialen Erstellung: Die Sammlung an Quizzen ist einmal zu erstellen. Hierfür ist mit circa 50 Arbeitsstunden für Lehrende zu rechnen. Danach können die Materialien mit geringen Anpassungen als Fundus über mehrere Semester hinweg genutzt werden.
Die Betreuung seitens der Tutor:innen (studentische Hilfskräfte) ist ein weiterer Personalaufwand. Dieser liegt bei einer viertägigen Intensiv-Phase bei rund 50 Stunden, wenn jede Phase mit zwei Tutor:innen unterstützt wird. Hierbei lassen sich aber die (oftmals bereits etablierten) Klausursprechstunden seitens Tutor:innen mit der Betreuung während der Intensiv-Phase kombinieren. An der TU Darmstadt ist die Finanzierung der Tutor:innen durch Beantragung von sogenannten QSL-Mitteln möglich.
Wie sehen die Lernaufgaben (am Beispiel Informatik) konkret aus?
Prinzipiell eignen sich für die Quizze alle Lernaufforderungen an Studierende, deren Antworten bis zu vier Sätzen bzw. acht Zeilen Rechnung bzw. Programmiercode umfassen. Diese Lösungen sind kurz genug, sodass die Studierenden diese direkt in das Antwortfeld in einer Moodle-Aufgabe eintragen können. Um längere Aufgaben zu kürzen, können Sie auch lediglich Teile der Lösung verlangen.
Beispiele für verschiedene Aufgabentypen:
- Betrachten Sie die Grafik/Rechnung/Implementierung. Gibt es Fehler? Wenn ja, welche und warum sind es Fehler?
- Korrigieren Sie alle Fehler in der Graphik/Rechnung/Implementierung.
- Schreiben/Wandeln Sie X in Y um.
- Beschriften Sie die Graphik mit den entsprechenden Fachbegriffen.
- Führen Sie die ersten zwei Schritte von Verfahren/Rechnung X durch.
Beispiele für Wissensfragen:
- Nennen Sie alle Aspekte/Eigenschaften/Vorteile/Nachteile/Konsequenzen von X!
- Was ist der Unterschied zwischen X und Y?
- Was versteht man unter X? Geben Sie zusätzlich ein konkretes Beispiel für X an.
- Ist es möglich mit X … zu machen? Begründen Sie. Wenn ja, führen Sie zusätzlich … mit X durch.
Was bringt das Klausurtraining?
Das gesamte Klausurtraining mit Quizzen während der Vorlesungszeit sowie die Intensiv-Phase ist freiwillig. Etwa ein Viertel der Studierenden nutzt die Quizze fortlaufend während der Vorlesungszeit. Ebenso nimmt ein Viertel an der Intensivphase teil. Wir betrachten unsere Studierenden als erwachsene Menschen. Wir können sie mit sinnvollen Lernstrategien und Materialien unterstützen und ermutigen, langfristig zu lernen. Letztendlich sind sie jedoch im Studium selbst für ihr Lernen verantwortlich.
Das Klausurtraining wird bereits seit zehn Semestern durchgeführt. Dieses Lernangebot gibt es sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester, in dem nur die Prüfung, aber nicht die Vorlesung angeboten wird. Die Wirksamkeit des Klausurtrainings bezüglich der Prüfungsnoten lässt sich nur schwer ermitteln, da keine Vergleichsdaten vorliegen. Die Studierenden, die am Klausurtraining teilnehmen, melden jedoch jedes Mal zurück, dass das Klausurtraining sie wesentlich in ihrer Vorbereitung unterstützt hat.
Autor:in:
Dr. Svana Esche, TU Darmstadt, Fachbereich Informatik