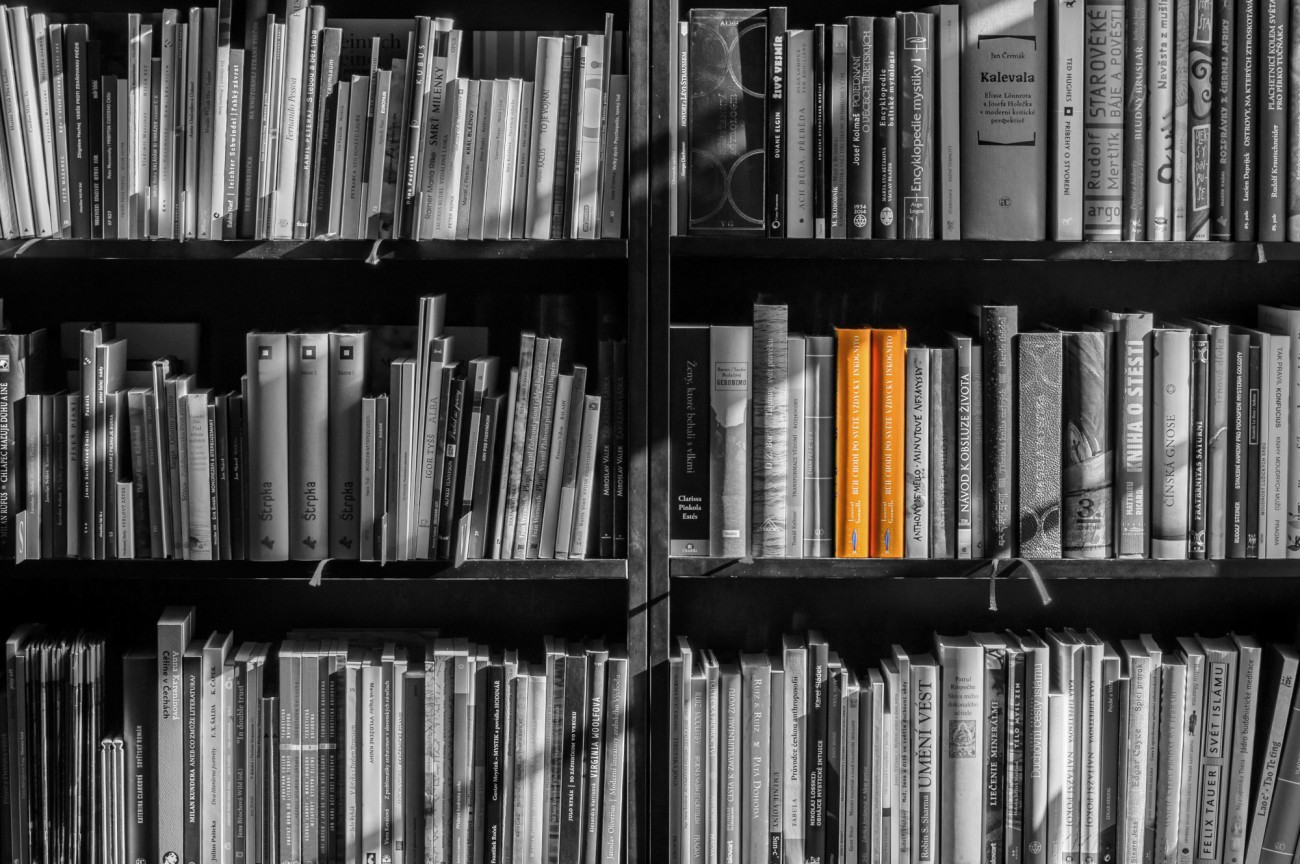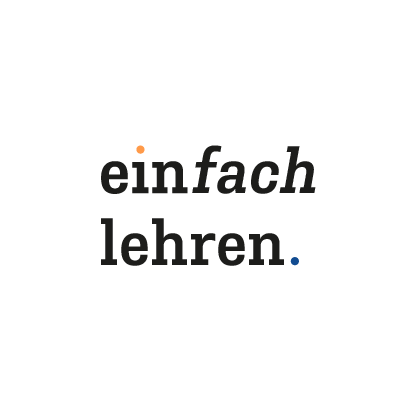Bewertungskriterien und Bewertungsraster gestalten
23.01.2023
23.01.2023 -- Klare Kriterien und Raster verbessern die Objektivität und Fairness von Leistungsbewertungen.

Als Lehrende stehen Sie vor der zentralen Aufgabe, Leistungen nicht nur zu erfassen, sondern auch fair und nachvollziehbar zu bewerten. Hierfür sind klare Bewertungskriterien und durchdachte Bewertungsraster unerlässlich. Sie bilden das Rückgrat einer objektiven Leistungsbeurteilung und sind ein Kernstück didaktisch fundierter Hochschullehre. Wer seine Prüfungen transparent gestaltet, schafft Vertrauen und fördert den Lernerfolg.
Ein Bewertungsraster ist dabei weit mehr als eine simple Punkteübersicht. Es ist ein methodisches Instrument, das Ihre Lehrziele systematisch abbildet. Durch gezielte Punktevergabe können Sie die Gewichtung einzelner Lernziele präzise festlegen. Das Ergebnis: eine deutlich höhere Objektivität, Zuverlässigkeit und Validität Ihrer Leistungseinschätzungen, die gleichzeitig den Korrekturprozess effizienter gestaltet.
Warum Präzision bei Prüfungen unerlässlich ist
Die sorgfältige Definition von Bewertungskriterien ist entscheidend für die Qualitätssicherung in der akademischen Lehre. Sie sichern:
- Transparenz und Gerechtigkeit: Studierende erhalten klare Orientierung, was von ihnen erwartet wird, und erfahren eine faire Behandlung.
- Erhöhte Reliabilität: Unabhängig vom Korrigierenden führen gut definierte Kriterien zu konsistenten und vergleichbaren Ergebnissen. Dies ist besonders bei großen Studierendengruppen an der Hochschule von Bedeutung.
- Validität der Messung: Sie stellen sicher, dass Ihre Prüfung tatsächlich die Kompetenzen und Lernziele erfasst, die Sie vermitteln möchten – und nicht lediglich die Reproduktion von Fakten.
- Effizienz im Korrekturprozess: Klare Regeln reduzieren Interpretationsspielräume und beschleunigen die Bewertung, auch bei der Arbeit im Team.
Zwei Prinzipien leiten die Kriterienentwicklung
Bei der Formulierung Ihrer Bewertungskriterien sollten Sie sich an zwei fundamentalen Prinzipien orientieren.
1. Zielorientierung
Jedes Bewertungskriterium muss einen direkten Bezug zu den formulierten Lehrzielen aufweisen. Bewerten Sie nur das, was auch gelernt werden sollte.
2. Niveaudifferenzierung
Ihre Kriterien müssen es ermöglichen, unterschiedliche Grade der Zielerreichung klar voneinander abzugrenzen. Insbesondere bei komplexeren Aufgaben, die mehr als eine „richtige“ oder „falsche“ Antwort zulassen, sollte erkennbar sein, welches Kompetenzniveau mit einer bestimmten Punktzahl einhergeht. Wenn beispielsweise ein Studierender bei einem ingenieurwissenschaftlichen Problem nur die Grundlagen benennen, aber nicht anwenden kann, sollte die Punktvergabe den Unterschied zum konzeptionellen Verständnis klar widerspiegeln.
Das Bewertungsraster: Ihr Werkzeug für strukturierte Leistungsbewertung
Nach der Gestaltung der Prüfungsaufgaben ist die Erstellung eines Bewertungsrasters der nächste logische Schritt. Es fungiert als detaillierter Leitfaden für die Bewertung und charakterisiert mögliche Aufgabenlösungen präzise. Für jede Aufgabe können Sie unterschiedliche Lösungsniveaus mit genauen Regeln definieren.
Abgestufte Punktvergabe
Legen Sie fest, wie viele Punkte für welche Leistungsstufe vergeben werden.
Definition von Lösungsmengen
Gerade bei offenen Fragen sind allgemeine Zuordnungsalgorithmen hilfreich, um unterschiedliche Ausdrucksweisen vergleichbar zu bewerten.
Ankerbeispiele
Konkrete Musterlösungen, die die Zuordnungsregeln greifbar machen und die Konsistenz der Bewertung sichern.
1. Musterlösung erstellen (empfohlen)
Obwohl optional, ist das Erstellen einer „idealen“ Musterlösung ein wertvoller erster Schritt. Tun Sie dies bereits während der Aufgabengestaltung, denn es fördert eine reflektiertere und präzisere Formulierung Ihrer Prüfungsfragen. Eine solche Musterlösung dient als Referenzpunkt für die spätere Bewertung.´
2. Bewertungskategorien festlegen
Entscheiden Sie, wie viele Bewertungsstufen für jede Aufgabe sinnvoll sind. Die Differenzierung hängt davon ab, wie spezifisch ein Lehrziel abgebildet wird und wie detailliert Sie das erreichte Niveau erfassen möchten.
- Beispiel: Bei der Fähigkeit, ein Integral aufzustellen, können einzelne Lösungsschritte in Bewertungskategorien unterteilt werden. Überlegen Sie, ob diese Schritte unterschiedliche Niveaus der zu prüfenden Kompetenz abbilden.
- Dichotome Bewertung: Ein einfaches „richtig“ oder „falsch“ kann sinnvoll sein, wenn eine klare Mindestanforderung die volle Punktzahl rechtfertigt und Vorkenntnisse als gegeben vorausgesetzt werden (z.B. in einer Vertiefungsveranstaltung).
- Unerwünschte Gewichtungen vermeiden: Achten Sie darauf, dass unterschiedliche Punkteskalen innerhalb einer Aufgabe keine ungewollten Gewichtungseffekte in der Gesamtbewertung erzeugen. Gegebenenfalls sind nachträgliche Gewichtungen notwendig, um die Relevanz der Aufgabe für das Lernziel widerzuspiegeln.
3. Niveaustufen detailliert beschreiben
Bestimmen Sie präzise, welche Merkmale eine Lösung auf einer bestimmten Niveaustufe aufweisen muss – was macht eine richtige, teilrichtige oder falsche Lösung aus?
- Bei geschlossenen Antworten ist dies oft unkompliziert.
- Bei offenen Antworten müssen Sie Entscheidungsregeln formulieren, die verschiedene Darstellungsformen berücksichtigen. Ein Beispiel: „Die korrekte Verwendung von Fachsprache ist Bestandteil der Bewertung; eine inhaltlich richtige, aber umgangssprachlich formulierte Antwort wird nur als teilrichtig eingestuft.“ Überlegen Sie systematisch, welche Aspekte einer Lösung genau bewertet werden sollen und wie Sie diese objektiv charakterisieren können.
4. Ankerbeispiele sammeln
Ankerbeispiele sind konkrete Lösungsversionen, die die zuvor festgelegten Zuordnungsregeln veranschaulichen. Sie können aus vergangenen Prüfungen stammen (anonymisiert), fiktiv sein oder beim Probelösen entstehen. Diese Beispiele machen die Bewertung „greifbarer“ und fördern die Konsistenz bei der Korrektur, insbesondere in Teams.
5. Regeln für die Punktevergabe festlegen
Das Ziel ist es, die Leistung eines Studierenden in einem nummerischen Wert abzubilden, der das erreichte Niveau differenziert abbildet.
- Gewichtung der Aufgaben: Die größte Herausforderung ist oft, zu entscheiden, welchen Anteil jede Aufgabe an der Gesamtnote hat. Fragen Sie sich: Welchen Beitrag leistet eine Aufgabe zur Erreichung eines bestimmten Lehrziels? Eine zweistufige Gewichtung – zunächst pro Aufgabe, dann pro Lehrziel in der Gesamtprüfung – kann hier Klarheit schaffen.
- Zeitaufwand vs. Lehrziel: Während Hochschulreglemente oft eine Orientierung am Zeitaufwand für die Lösung einer Aufgabe vorgeben, ist dies aus didaktischer Sicht kritisch zu hinterfragen. Zeitaufwand ist nicht immer ein valider Maßstab für das Erreichen eines Lehrziels. Falls der Zeitaufwand vorgegeben ist, überlegen Sie, wie Sie die Aufgaben so anpassen können, dass sich der Zeitaufwand mit der von Ihnen angestrebten didaktischen Gewichtung deckt.
Praxishinweise für die Bewertung
- Teamkorrektur: Bei der Korrektur im Team ist eine gemeinsame Schulung oder ein detailliertes Informationsblatt zum Bewertungsraster essenziell, um eine einheitliche Linie sicherzustellen.
- Umgang mit Grenzfragen: Treten während der Korrektur unklare Fälle auf, fügen Sie diese dem Bewertungsraster als „Grenzfälle“ hinzu und definieren Sie – nach Absprache im Team – eine verbindliche Entscheidungsregel. Informieren Sie alle Korrigierenden über solche Ergänzungen.
- Zweitkorrektur zur Absicherung: Eine stichprobenartige Zweitkorrektur kann die Zuverlässigkeit der Bewertung signifikant erhöhen, besonders bei offenen Aufgaben. Prüfen Sie dabei stets die rechtlichen Rahmenbedingungen Ihrer Hochschule bezüglich des Zweiprüferprinzips.
Beispiel zur Veranschaulichung der Kriterienfestlegung
Im ersten Teil der Beispielaufgabe wird eine grundlegende Rechenoperation im Kontext eines Alltagsbeispiels abgefragt: die Berechnung eines rabattierten Preises. Dies dient der Überprüfung fundamentaler mathematischer Kompetenzen.
Aufgabe: Kauf eines Blu-ray-Players
Ein Online-Shop bietet einen tragbaren Blu-ray-Player an. Der ursprüngliche Preis von 99,99 € wird um 20 % reduziert. Bei Abbuchung vom Bankkonto gibt es auf diesen reduzierten Preis nochmals 5 % Rabatt.
Gib den Preis für den DVD-Player an, wenn man ihn ohne Abbuchung vom Bankkonto bezahlt. Runde auf ganze Cent.
Bewertungskriterien für Teilaufgabe 1
- Skalierung: Dichotom (richtig/falsch). Die Aufgabe erfordert ein einziges, korrektes Ergebnis.
- Entscheidungsregel: Die Bewertung basiert ausschließlich auf dem Endergebnis. Die korrekte Rundung auf ganze Cent ist hierbei integraler Bestandteil der zu prüfenden Fähigkeit. Hinweis: Bei Aufgaben, die Zwischenschritte oder separate Rundungsregeln erfordern, wäre eine teilrichtige Bewertung denkbar.
Im zweiten Teil der Beispielaufgabe geht es um eine komplexere Fähigkeit: das mathematische Argumentieren. Hier sollen Studierende eine Behauptung überprüfen und ihre Antwort begründen.
Aufgabe: Analyse und Begründung von Prozentrechnungen
Statt zunächst den Preisnachlass von 20% und anschließend den Rabatt von 5% abzuziehen, kann man auch einmalig 25% vom Preis des DVD-Players abziehen.
Ist diese Behauptung richtig? Ja oder nein. Begründe Deine Antwort!
Bewertungskriterien für Teilaufgabe 2
- Dichotome Bewertung trotz offenem Antworttyp: Obwohl die Begründung Spielraum für individuelle Formulierungen bietet, wird die Bewertung hier dichotom (richtig/falsch) vorgenommen.
- Kompetenzfokus: Die korrekte Lösung muss das Verständnis des „Grundwerte-Prinzips“ erkennen lassen. Studierende müssen argumentieren können, dass der zweite Rabatt (5%) nicht vom ursprünglichen Preis, sondern vom bereits reduzierten Preis abgezogen wird. Eine einfache Addition der Prozentsätze ist daher falsch, da die Bezugsgrößen unterschiedlich sind. Die Behauptung ist somit „Nein“.
- Anforderung an die Begründung: Die Begründung, ob rechnerisch oder sprachlich, muss diesen Bezug auf die variierenden Grundwerte klar herstellen. Lösungen, die zwar sinngemäß richtig sind, aber keinen konkreten Bezug zu den sich ändernden Grund- oder Ausgangswerten herstellen, werden als falsch eingestuft, da das geforderte Mindestniveau im Kompetenzverständnis nicht erreicht ist.
- Ganzheitliche Bewertung: Beide Elemente dieser Teilaufgabe (Ankreuzen und Begründen) werden als eine Lösungseinheit betrachtet. Die Begründung gilt als integraler Bestandteil der zugrundeliegenden Kompetenz des mathematischen Argumentierens. Dies minimiert auch die Verzerrung durch die Ratewahrscheinlichkeit beim Ankreuzen der dichotomen Frage.
Eine Investition in die Lehrqualität
Die konsequente Anwendung und Entwicklung präziser Bewertungskriterien und -raster ist eine zentrale Aufgabe der Hochschuldidaktik. Sie professionalisiert Ihre Lehre, sichert faire und transparente Prüfungen und trägt maßgeblich zu einem nachhaltigen Lernerfolg Ihrer Studierenden bei.