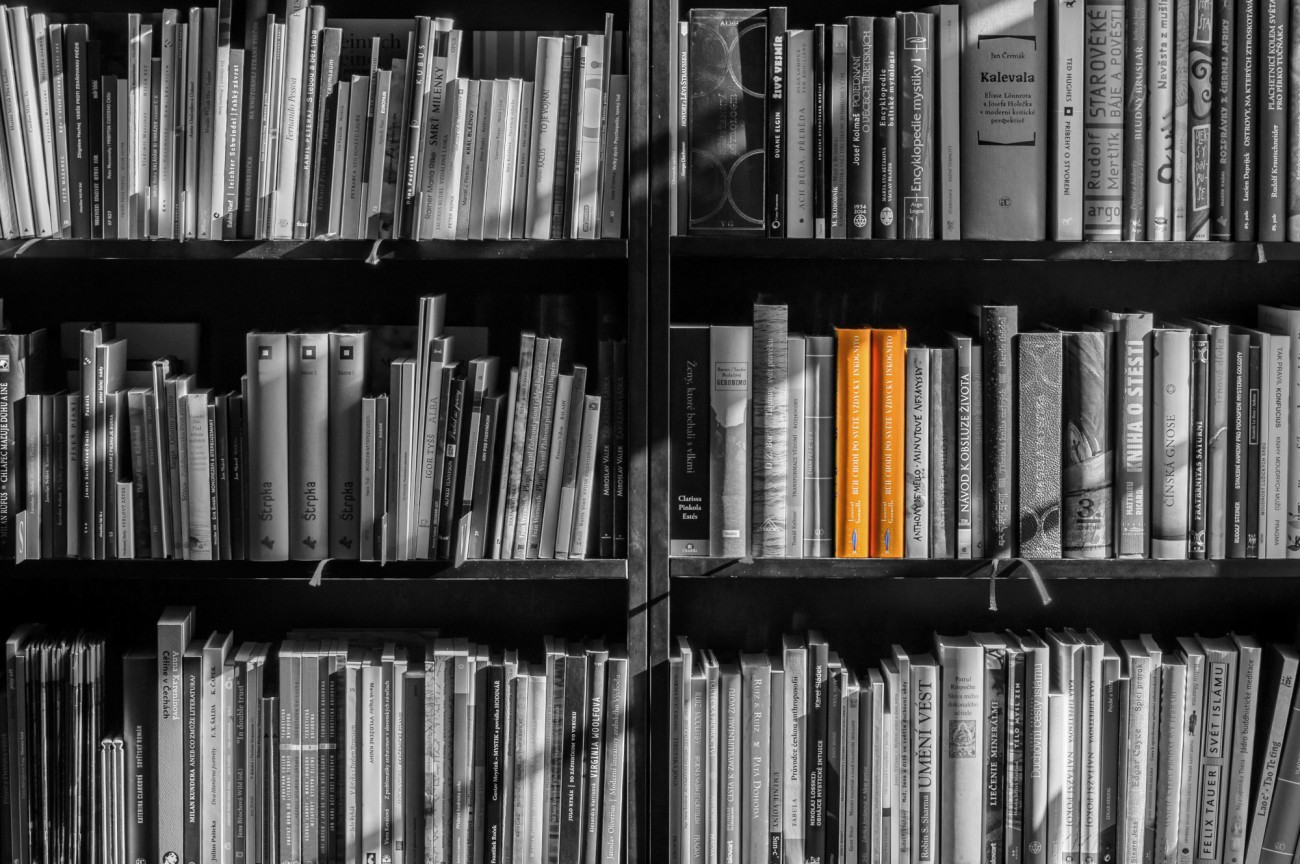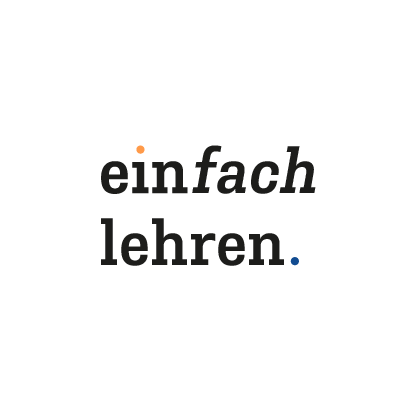Humor in der Lehre: Mehr als nur ein Lacher?
31.01.2024
Humor verbessert die Lernmotivation, reduziert Stress und macht Lehre interessanter.


„Ich liebe diesen Humor in seiner Vorlesung, es lohnt sich schon allein deshalb, hinzugehen.“ Solche Sätze hört man immer wieder von Studierenden, wenn sie über Lehrveranstaltungen sprechen. Es liegt auf der Hand: Studierende schätzen Spaß und Lachen in der Lehre. Doch stellt sich die Frage: Lenkt Humor nicht vom eigentlichen Lerninhalt ab? Oder kann er sogar das Lernen fördern?
Warum Lachen in der Lehre wirkt: Funktionen und Effekte von Humor
Studierende zum Lachen oder Schmunzeln zu bringen, ist weit mehr als nur Unterhaltung. Es erfüllt wichtige Funktionen für Lernen und Motivation und kann die Lehrveranstaltung maßgeblich bereichern:
1. Verbesserung der Arbeitsatmosphäre
Humor, der positiv und nicht abwertend ist, verbessert die gesamte Arbeitsatmosphäre in Lehrveranstaltungen (Banas, Dunbar, Rodriguez, & Liu, 2011; Gorham & Christophel, 2008). Eine entspannte und angenehme Atmosphäre erleichtert das Lernen erheblich, da Studierende sich sicherer und wohler fühlen, was die Offenheit für neue Inhalte steigert.
2. Reduktion von Anspannung und Steigerung der Aufnahmefähigkeit
Lachen reduziert nachweislich Anspannung (Gorham & Christophel, 2008). Wenn Studierende weniger gestresst sind, werden sie aufnahmefähiger und kreativer. Diese Gelassenheit kann helfen, auch komplexe oder herausfordernde Themen besser zu durchdringen.
3. Steigerung des Interesses und der Anwesenheit
Eine Lehrveranstaltung wird durch gezielten Humor interessanter und attraktiver (Wanzer, 2002). Das führt oft dazu, dass Studierende diese Veranstaltungen lieber und regelmäßiger besuchen, was wiederum die Kontinuität des Lernprozesses fördert.
4. Erhöhung der Anstrengungsbereitschaft und Aufmerksamkeit
Wenn Studierende ihre Lehrenden aufgrund deren humorvoller Art mögen, steigt auch ihre Anstrengungsbereitschaft für gestellte Aufgaben (Wanzer, 2002). Humor wirkt zudem anregend und weckt die Aufmerksamkeit der Studierenden (Wanzer, 2002). Neue Informationen können so besser behalten werden, insbesondere wenn die humorvolle Kommunikation direkt auf den Lernstoff bezogen ist (Banas et al, 2011; Gorham & Christophel, 2008).
5. Positive Evaluationen und reduzierte Distanz
Lehrveranstaltungen zeigen bessere Evaluationsergebnisse, wenn Lehrende Humor einsetzen (Bryant, Comisky, Crane & Zillmann, 1980). Dies gilt jedoch nicht für abwertenden, aggressiven Humor oder Sarkasmus (Banas et al., 2011). Darüber hinaus nimmt die Sympathie für die Lehrenden zu (Banas et al., 2011), da angemessener Humor die psychologische Distanz zwischen Lehrenden und Studierenden abbaut und eine nahbarere Beziehung schafft.
Was ist Humor? Eine Definition
Humor lässt sich als eine vielschichtige Fähigkeit beschreiben, die zwei zentrale Aspekte umfasst:
- Andere zum Lachen bringen: Humor ist die Kunst, für andere amüsant oder komisch zu sein und sie so zum Lachen oder Schmunzeln zu bringen (Lovorn & Holaway, 2015). Es geht darum, durch Worte, Gesten oder Situationen Heiterkeit zu erzeugen und eine positive Stimmung zu schaffen.
- Mit Heiterkeit und Gelassenheit reagieren: Darüber hinaus bedeutet Humor auch die Fähigkeit, selbst auf bestimmte Dinge oder Situationen heiter und gelassen zu reagieren (Dudenredaktion, o. J.). Dies schließt eine gewisse Distanz zu Herausforderungen und die Bereitschaft ein, auch die komischen Seiten des Lebens zu sehen.
Zusammenfassend ist Humor also sowohl die aktive Fähigkeit, Heiterkeit zu verbreiten, als auch eine innere Haltung der Gelassenheit und des Schmunzelns gegenüber der Welt.
Vorsicht in Prüfungssituationen: Wann Humor nicht angebracht ist
In Prüfungssituationen sollten Lehrende Humor nur mit großer Vorsicht einsetzen. Obwohl humorvolle Bemerkungen potenziell Anspannung oder Prüfungsangst reduzieren könnten, ist die Bereitschaft der Studierenden zur Heiterkeit in diesen Momenten oft sehr niedrig, und ihre Ernsthaftigkeit hoch ausgeprägt. Der sogenannte „Humorrahmen“ ist dann nicht gegeben (Ruch & Zweyer, 2001).
Humor von Prüfenden kann in solchen Situationen leicht zu Verunsicherung, Irritation oder zusätzlichem Stress führen. Studierende, die generell eine hohe Ängstlichkeit davor haben, ausgelacht zu werden, werden selbst gut gemeinten Humor negativ interpretieren (Ruch, Hofmann, Platt & Proyer, 2014).
Podcast: Humor in der Lehre – Die studentische Sicht
Einblicke in die studentische Perspektive auf Humor in Lehrveranstaltungen bietet der Podcast „Humor in der Lehre – Die studentische Sicht“. Hören Sie rein, um zu erfahren, wie Studierende den Einsatz von Humor wahrnehmen und welche Effekte er auf ihre Lernerfahrung hat.
Humor in der Lehre: Die richtige Art macht den Unterschied
Nicht jeder Humor ist für den Lehrkontext gleichermaßen geeignet. Tatsächlich gibt es Humortypen, die von Studierenden sehr positiv aufgenommen werden, während andere nur unter bestimmten Bedingungen gut ankommen oder sogar destruktive Wirkungen haben können. Eine bewusste Auswahl der Humorform ist daher entscheidend für ihren Erfolg in der Lehre.
Basierend auf der umfassenden Arbeit von Banas und Kollegen (2011) lassen sich Humortypen nach ihrer Angemessenheit im Lehrkontext kategorisieren.
Humortypen in der Lehre: Was wirkt und was nicht
| Freundlich, auf Solidarität basierend | Andere amüsieren, Solidarität aufbauen, Spannung abbauen | Angemessen |
| Psychologische Bedürfnisse, selbstverstärkend | Humor, um sich selbst zu verteidigen (z. B. wenn einem eine Panne oder Peinlichkeit passiert ist); Emotionen regulieren; mit Problemen umgehen, die im Laufe der Interaktion aufgekommen sind | Angemessen |
| Mit dem Lernmaterial assoziierter Humor | Geschichten, Witze oder andere humoristische Inhalte, die mit dem Lernmaterial assoziiert sind | Angemessen |
| Lustige Geschichten / Anekdoten | Anlässe oder Aktivitäten zusammengefasst in einer Geschichte | Angemessen |
| Humoristische Kommentare | Ein kurzes Statement mit einem humoristischen Element | Angemessen |
| Humor bei Anderen suchen | Humor in anderen ermuntern oder andere suchen, die bekannt dafür sind lustig zu sein | Angemessen |
| --- | --- | --- |
| Mit dem Lernmaterial nicht assoziierter Humor | Geschichten, Witze oder andere humoristische Inhalte, die nicht mit dem Lernmaterial assoziiert sind | Je nach Kontext |
| Selbstironie | Sich selbst zum Ziel des Humors machen | Je nach Kontext |
| Ungeplanter (spontaner) Humor | Nicht-intentionaler, spontaner Humor | Je nach Kontext |
| Witze oder Rätsel | Spannungsaufbau mit einer Pointe | Je nach Kontext |
| Wortspiele | Spielen mit der Mehrdeutigkeit von strukturell oder phonetisch ähnlichen Worten oder mit Worten, die zwei oder mehr Bedeutungen haben | Je nach Kontext |
| Flacher Humor | In spezifischen Situation sich dämlich, ungeschickt oder absurd verhalten | Je nach Kontext |
| Nichtverbaler Humor | Gesten, lustige Gesichtsausdrücke, Tonfall usw. mit humoristischer Absicht einsetzen | Je nach Kontext |
| Imitationen | Ausdruck oder Stimme von berühmten Personen imitieren | Je nach Kontext |
| Sprachspiele | Geistreiche oder kluge verbale Kommunikation, einschließlich Slang und Sarkasmus | Je nach Kontext |
| Lachen | Lachen in unterschiedlicher Intensität um andere zum Lachen zu bringen | Je nach Kontext |
| Gebrauch von lustigen Requisiten | Gebrauch von lustigen Requisiten wie Wasserspritzpistolen, lustige Karten, Clownsnase usw. | Je nach Kontext |
| Bildliche Illustrationen | Gebrauch von Bildern, Cartoons oder Gegenständen, die andere zum Lachen bringen sollen | Je nach Kontext |
| Humoristische Übertreibungen/Verzerrungen | Gebrauch von ironischen oder komischen Übertreibungen | Je nach Kontext |
| Testaufgaben | Aufgaben in Tests, die Humor beinhalten | Je nach Kontext |
| --- | --- | --- |
| Aggressiv, andere verunglimpfen | Andere manipulieren oder verunglimpfen, sich über bestimmte Andere lustig machen, Spotten | Unangemessen |
| Offensiver Humor | Humor, der auf Rasse, Ethnie, Geschlecht, politische Zugehörigkeit, sexueller Orientierung basiert | Unangemessen |
Effektiver Humor: Stoffbezug ist der Schlüssel
Auf Basis der Forschung von Banas und Kollegen (2011) zeigt sich deutlich: Besonders effektiv für den Lernerfolg sind Humortypen, die sich direkt auf den Lehrstoff beziehen. Dieser stoffbezogene Humor dient nicht nur der Unterhaltung, sondern vertieft das Verständnis und die Erinnerung an die Inhalte.
Praktische Tipps für stoffbezogenen Humor
- Für viele Themenbereiche finden sich passende Sequenzen aus Cartoons, Memes oder Karikaturen. Diese können als visuelle Anker dienen und trockene Inhalte auflockern, während sie gleichzeitig eine Brücke zum Lernstoff schlagen.
- Anekdoten, die sich auf den Stoff beziehen, sind ebenfalls gewinnbringend. Sie können komplexe Zusammenhänge veranschaulichen, persönliche Bezüge herstellen und so das Engagement der Studierenden erhöhen.
Was Sie tun sollten (Do's)
- Bleiben Sie authentisch. Versuchen Sie nicht, jemand zu sein, der Sie nicht sind. Der wirkungsvollste Humor ist der, der zu Ihrer Persönlichkeit passt und sich natürlich anfühlt.
- Stimmen Sie sich auf Ihr Publikum ein. Was als lustig empfunden wird, ist stark von Generation, Geschlecht und kulturellem Hintergrund der Studierenden abhängig. Seien Sie sensibel für die Gruppendynamik und passen Sie Ihren Humor entsprechend an.
- Priorisieren Sie stoffbezogenen Humor. Humor, der einen direkten Bezug zum Lerninhalt hat, ist besonders wirksam für das Lernen, da er die Erinnerung an den Stoff erleichtert. Nach einem Lacher sollten Sie das Gelernte noch einmal in eigenen Worten zusammenfassen, um die Verankerung im Gedächtnis zu sichern. Humor ohne direkten Stoffbezug kann zwar als Eisbrecher dienen, die Aufmerksamkeit wieder wecken und eine positive Atmosphäre schaffen, birgt aber auch das Risiko der Ablenkung. Achten Sie hier darauf, die Aufmerksamkeit bewusst zum Lehrstoff zurückzuführen, bevor Sie fortfahren.
- Nutzen Sie Selbstironie mit Bedacht. Selbstironie kann Sie menschlich erscheinen lassen und gut bei Studierenden ankommen. Achten Sie jedoch darauf, Ihre Glaubwürdigkeit nicht zu untergraben. Setzen Sie Selbstironie nur ein, wenn Sie sich Ihrer Kompetenz sicher sind und als ausreichend qualifiziert wahrgenommen werden. Ein Beispiel hierfür finden Sie unter „Humor in der Lehre: Anekdote“, wo ein Psychologie-Dozent eine selbstironische Geschichte aus seiner Studienzeit erzählt.
- Greifen Sie auf externe Hilfsmittel zurück. Wenn Sie nicht zu den spontan humorvollen Menschen gehören, integrieren Sie Videos, Cartoons, Memes, Links oder Hörbeispiele, um humorvolle Elemente einzubringen.
- Stärken Sie den direkten Kontakt auf andere Weise. Wenn der Einsatz von Humor für Sie keine Option ist oder sich unnatürlich anfühlt, gibt es viele andere Wege, um eine positive Atmosphäre zu schaffen und den Lernerfolg zu fördern. Lächeln, Lachen, stimmliche Varianz und eine lebendige Körpersprache können sogar noch wirksamer sein als Humor selbst.
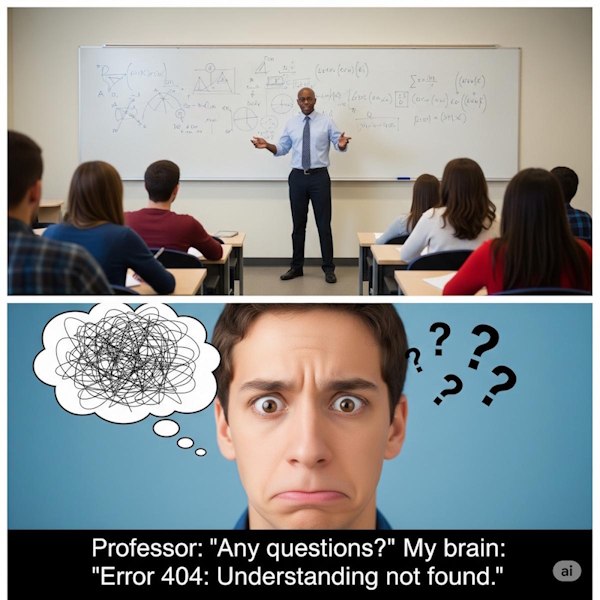
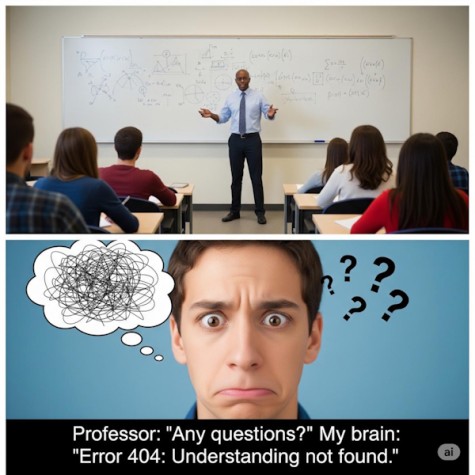
Was Sie vermeiden sollten (Don'ts)
- Machen Sie niemals Witze auf Kosten Studierender. Bloßstellungen – insbesondere einzelner anwesender Studierender – sind absolut tabu. Auch wenn die Betroffenen oder andere Studierende in dem Moment lachen mögen, fühlen sich die bloßgestellten Personen oft vorgeführt. Dies kann dazu führen, dass Studierende sich aus Angst vor ähnlichen Erfahrungen zukünftig weniger in Lehrveranstaltungen beteiligen. Zudem legitimieren Lehrende mit solchem Verhalten aggressiven Humor und agieren als schlechtes Vorbild. Lachen Sie mit den Studierenden, anstatt über sie!
- Vermeiden Sie Sarkasmus und Zynismus. Spöttische, höhnische oder entwertende Aussagen, wie sie im Sarkasmus oder Zynismus vorkommen, kommen in der Regel nicht gut an und können das Vertrauensverhältnis stören.
- Übertreiben Sie es nicht. Selbst wenn Sie von Natur aus sehr humorvoll sind, sollte Humor dosiert eingesetzt werden, um nicht zu sehr vom eigentlichen Lernstoff abzulenken. Finden Sie ein gesundes Mittelmaß.
- Vermeiden Sie „verunglückten“ Humor. Wenn Sie nicht gut darin sind, Witze zu erzählen oder lustige Geschichten vorzutragen, lassen Sie diese Art von Humor lieber weg. Alternativ können Sie humoristische Einlagen im privaten Umfeld üben und sich kritische Rückmeldung geben lassen.
Methodische Ideen: Humor und Spaß in der Lehre erzeugen
Humor lässt sich nicht nur spontan einsetzen, sondern auch durch gezielte methodische Elemente in Lehrveranstaltungen integrieren. Diese Ansätze können die Lernatmosphäre auflockern, die Aufmerksamkeit steigern und die Interaktion fördern.
ㅤ
Kopfstandmethode: Probleme humorvoll umkehren
Die Kopfstandmethode ist eine kreative Technik, die Studierende dazu anregt, Problemstellungen aus einer umgekehrten Perspektive zu betrachten. Statt zu fragen „Was muss getan werden, damit es besser wird?“, formulieren Sie die Aufgabe provokant um:
- „Was müssen wir tun, damit die Qualität unseres Projekts maximal sinkt?“
- „Welche Empfehlungen geben Sie, damit dieser Konflikt garantiert eskaliert?“
Dieser Ansatz erzeugt nicht nur Lachen, sondern fördert auch unkonventionelles Denken und ein tieferes Verständnis der Ursachen und Wirkmechanismen eines Problems.
ㅤ
Fingierter Handyanruf: Relevanz spielerisch vermitteln
Ein fingierter Handyanruf kann eine überraschende und unterhaltsame Methode sein, um die Gliederung einer Vorlesung vorzustellen oder die Relevanz von Themen zu unterstreichen. Schauspielern Sie, als würde Sie ein Kollege oder eine Expertin anrufen, der/die beispielsweise wissen möchte, was Sie heute behandeln. Bitten Sie die Studierenden um Ruhe wegen einer angeblich schlechten Verbindung und nutzen Sie die Gelegenheit, um die Inhalte der Sitzung oder deren Praxisbezug zu erläutern.
Um den Effekt zu steigern, können Sie zum Beispiel mit einer Beamer-Fernbedienung „telefonieren“. Diese Idee stammt von Professor Dr. Michael Suda (TU München) und wurde von Röbke (2012) publiziert. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bündeln und gleichzeitig ein Schmunzeln hervorzurufen.
ㅤ
Tabu mit Fachbegriffen: Hörsaalspiel
Das klassische Spiel Tabu lässt sich hervorragend an den Lehrkontext anpassen. Teilen Sie die Studierenden in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe erhält Fachbegriffe aus dem aktuellen Vorlesungsthema, die sie der anderen Gruppe erklären muss. Dabei dürfen fünf vorher festgelegte „Tabu-Wörter“ nicht verwendet werden. Dieses Spiel fördert nicht nur die Kommunikation und das Verständnis von Fachtermini, sondern sorgt auch für viel Heiterkeit und Interaktion.
ㅤ
Schlagzeile des Tages: Lernergebnisse kreativ zusammenfassen
Lassen Sie Studierende gegen Ende einer Lehrveranstaltung eine Schlagzeile für eine frei wählbare Zeitung (z. B. eine Boulevardzeitung, ein Fachblatt oder eine satirische Zeitung) über den heute behandelten Stoff formulieren. Die Schlagzeile darf auch eine witzige oder überraschende Erkenntnis hervorheben. Lassen Sie die Studierenden ihre Schlagzeilen reihum vorlesen. Diese Methode fördert die Zusammenfassung des Gelernten, regt zur kreativen Formulierung an und beendet die Sitzung mit einem humorvollen Höhepunkt.
Weiterführende Lektüre: Den eigenen Humor entwickeln
Möchten Sie Ihren eigenen Humor gezielt weiterentwickeln und als Werkzeug für den Alltag nutzen? Dann lohnt sich ein Blick in:
- McGhee, P. (2010). Humor as survival training for a stressed-out world: The 7 humor habits program. Author House.
Dieses Werk bietet praktische Ansätze, um die eigene humorvolle Seite zu stärken und die positiven Effekte von Humor in verschiedenen Lebensbereichen zu nutzen.