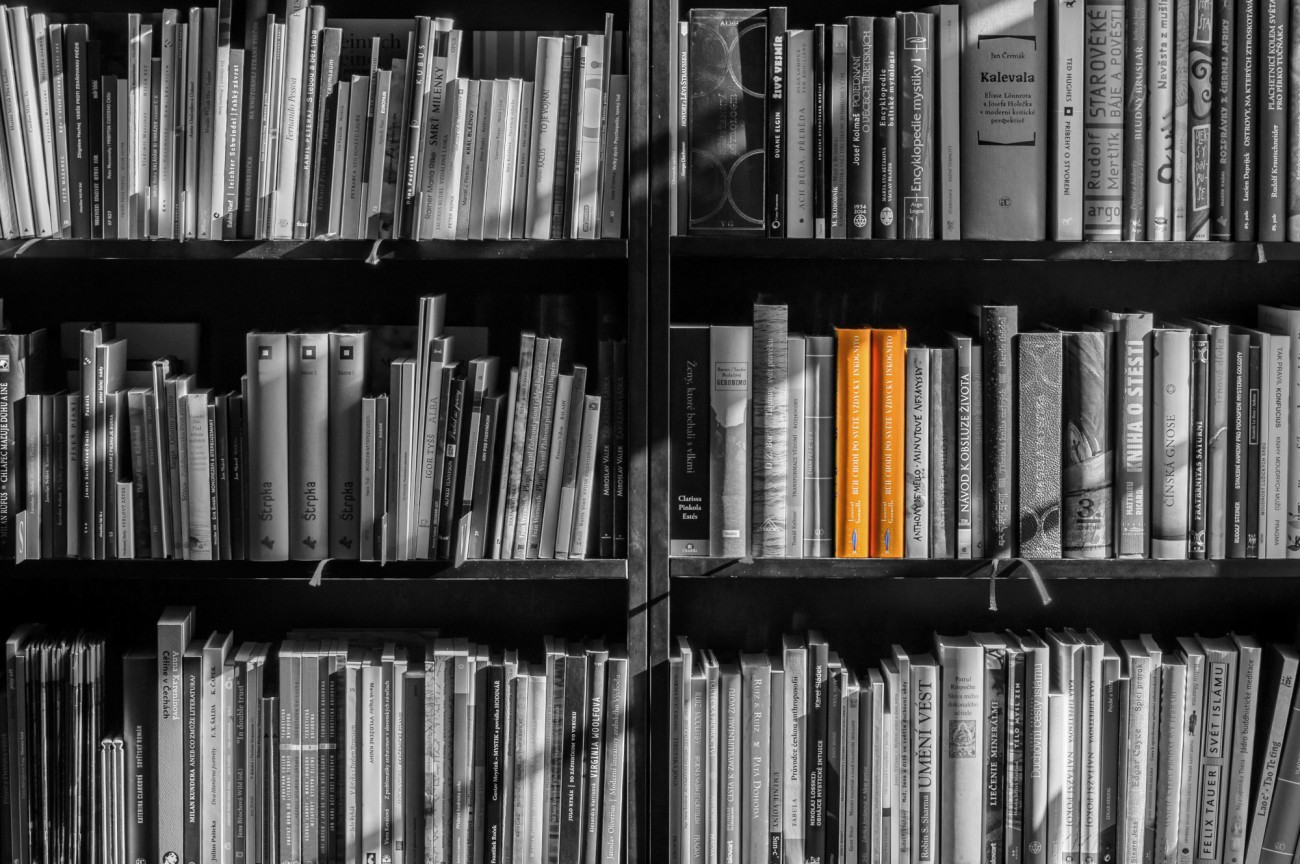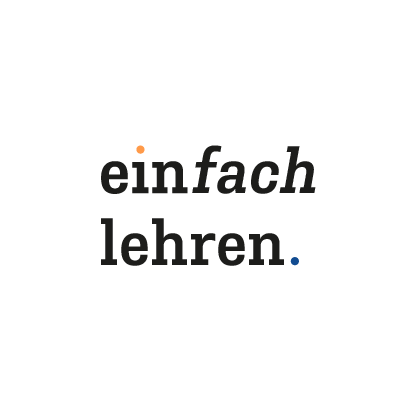Makerspaces als Lernort neuer Ingenieur:innenkultur
25.08.2025
Von der Werkstatt zur Ideenfabrik: Anforderungen und Praxisbeispiele

Die sogenannte ‚Maker-Bewegung‘ entwickelte sich in den USA aus der Hacker- und Do-it-yourself-Kultur der 2000er Jahre. In dieser Zeit wurden Arduino-Mikrocontroller, der Raspberry Pi und erste 3D-Drucker für die Allgemeinheit verfügbar und es verbreiteten sich zunehmend Open-Source-Software und Anleitungen zur Nutzung dieser Tools im Internet. Das Potenzial der Maker-Bewegung wurde bald auch im Bildungsbereich erkannt. ‚Making‘ wurde zu einer Form des aktiven, innovativen und techniknahen Lernens und es entstanden experimentelle Werkstätten, die sogenannten ‚Makerspaces‘, als offene, kreative, technische Lernumgebungen.
Insbesondere mit Bezug auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 hielt die Maker-Education Einzug in die ingenieurwissenschaftliche Hochschulbildung. Seither gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, da sie eine unmittelbare Verbindung von innovationsorientierter Produktentwicklung, Hands-on-Learning und theoriegeleitetem Handeln darstellt. Die Möglichkeit, eigene kreative Projekte zu realisieren führt bei Studierenden zu schnellen Erfolgserlebnissen, fördert so den Spaß am Umgang mit Technik und erleichtert den Zugang zu komplexen technischen Themenbereichen. Ergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit hochschulischer Makerspaces zeigen bei Studierenden beispielsweise eine Steigerung der Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit als (Technik-) Entwickler:innen (Morocz et al., 2016).
Lernen durch kreatives Problemlösen
Beim Arbeiten im Makerspace lernen Studierende, indem sie Dinge tun, beobachten, scheitern, neu denken – und in Teams gemeinsam Lösungen entwickeln. Dabei entstehen nicht nur Prototypen technischer Lösungskonzepte, sondern auch fachliches Wissen. Studierende durchlaufen den gesamten Innovationsprozess von der Ideenfindung über die Konstruktion bis zur Umsetzung. Soll beispielsweise ein einfacher Roboter gebaut werden, der Objekte an einer Stelle aufnimmt und an einer anderen Stelle absetzt, müssen dafür mechanische Prinzipien verstanden, Algorithmen programmiert, CAD-Modelle entwickelt und Fertigungsverfahren angewendet werden. Die Grenzen zwischen Theorie und Praxis verschwimmen – das technische Lernen wird kontextualisiert und damit nachhaltiger (Halverson & Sheridan, 2014).
Makerspaces werden in der Regel sowohl für formale als auch für extracurriculare Lernprozesse konzipiert. Typische Szenarien sind dabei einerseits die Einbindung in Lehrveranstaltungen und Abschlussarbeiten und andererseits das Angebot zum freien und kreativen Arbeiten außerhalb konkreter Leistungsanforderungen im Studium. Die folgenden Beispiele geben Ihnen einen Einblick, wie diese Lernumgebungen gestaltet und in die Lehre eingebunden werden können.
Beispiele aus der Hochschulpraxis
machBAR@PTW (TU Darmstadt)
(https://www.ptw.tu-darmstadt.de/studium/machbar_ptw)
Im Rahmen der FlowFactory der TU Darmstadt wurde die machBAR@PTW eröffnet. Sie dient sie als kreativer Raum für Studierende und Lehrende des Fachbereichs Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) und bietet eine ‚Social Area‘ mit Whiteboards und Präsentationsmöglichkeiten sowie eine umfangreich ausgestattete Werkstatt mit Elektronikarbeitsplätzen, 3D-Druckern und Lasercuttern sowie Werkzeuge und Maschinen zur manuellen Metall- und Holzbearbeitung.
Die Einbindung in die Lehre erfolgt im Rahmen studentischer Arbeiten am PTW. Zusätzlich ist die machBAR@PTW im Rahmen definierter Öffnungszeiten und mit Voranmeldung für alle Studierenden zugänglich.
UnternehmerTUM MakerSpace (TU München)
Der bekannteste und größte Makerspace an einer deutschen Hochschule befindet sich an der TU München. Verteilt auf zwei Standorte stehen Maschinen wie CNC-Fräsen, Lasercutter, Wasserstrahlschneider, 3D-Drucker sowie Metall-, Holz-, Elektro- und Textilarbeitsplätze zur Verfügung. Der Makerspace wird sowohl von Studierenden und der (privaten) Maker-Community, als auch von Startups und der Industrie genutzt. Er ist über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft oder Gebühren für einzelne Nutzungstage und Kursangebote öffentlich und für Unternehmen zugänglich.
Die Einbindung in die Lehre erfolgt im Wesentlichen im Rahmen von interdisziplinären Projektkursen wie dem Format ‚Think.Make.Start‘, in dem Studierende in interdisziplinären Teams innovative Produkte für reale Herausforderungen entwickeln.
M.EE – Makerspace Engineering Education (TU Dortmund)
Im M.EE an der TU Dortmund können Studierende in einem deutlich kompakteren Setting ebenfalls Fertigungstechnologien wie 3D-Drucker, Lasercutter und CNC-Fräsen sowie Elektronik-, Metall- und Holzarbeitsplätze aber auch Präsentationsmöglichkeiten, VR-Technik und ein Podcast-Studio nutzen. Der M.EE steht für Studierende der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund zur Verfügung. Die Nutzung ist kostenfrei und für Projekte, die Bezug zum Studium haben, stehen im begrenzten Umfang gängige Materialien und Werkstoffe frei zur Verfügung.
Eine Einbindung in die Lehre erfolgt zudem im Rahmen der ‚Ingenieure ohne Grenzen Challenge‘, an der die Studierenden im Rahmen eines Wahlmoduls teilnehmen können. In einem hochschulübergreifenden Wettbewerb entwickeln sie nachhaltige, praktikable sowie kulturell angepasste Lösungen zu technischen Entwicklungsthemen und Strukturproblemen in Entwicklungsländern. Die technischen Lösungsideen und Konzepte werden dabei als funktionsfähige Prototypen im Makerspace entwickelt und realisiert. Zudem ist das Konzept der ‚Maker-Education‘ auch als fachdidaktisches Element in den technischen Lehramtsstudiengängen verankert.
Anforderungen an die Lernumgebung Makerspace
Aus der praktischen Erfahrung können einige wesentliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen identifiziert werden, die mit dem Einsatz von Makerspaces als Lernumgebungen in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen einhergehen (vgl. Frye & Haertel, 2024):
- Maker-Education ist durchaus anspruchsvoll. Nur mit einer hinreichend großen Auswahl an technischen Ressourcen, Materialien, Werkzeugen und Technologien ist die Umsetzung komplexer und dauerhaft auch reizvoller und motivierender Projekte durch die Studierenden möglich.
- Ausreichend Platz, geeignete Sicherheitseinrichtungen sowie eine stabile Energie- und Internetversorgung sind grundlegende technische Anforderungen. Die Studierenden sollten sich wohlfühlen und ausbreiten können, alle Materialien und Technologien müssen unmittelbar präsent und leicht zugänglich sein, um aktiv genutzt zu werden.
- Betreuende benötigen Aus- und Weiterbildung sowohl hinsichtlich der technischen als auch didaktischen Anforderungen (z.B. zum Einsatz von Kreativitätstechniken oder zur Betreuung studentischer Projekt-Teams), um das Konzept der Maker-Education und die vorhandenen Technologien zu verstehen und nach außen vertreten zu können. Entsprechende Weiterbildung finden Sie im hochschuldidaktischen Programm.
- Studierende tun sich oftmals schwer, einen Makerspace initiativ für eigene, freie Projekte zu nutzen. Eine curriculare Einbindung und Anknüpfung an konkrete Lehrveranstaltungen erleichtern ihnen den Einstieg. Das Weitermachen und Wiederkommen können zudem gute und leicht zugängliche Anleitungen unterstützen.
- Maker-Education benötigt Zeit zum Kennenlernen, zum Einarbeiten, zum Erklären, zum Verwerfen und nochmal neu anfangen und zum Ausprobieren. Dies gilt sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden.
Fazit
Makerspaces sind flexible Lernumgebungen: als Infrastruktur für projektbasierte Lehre, als Impulsgeber für neue Lehrformate oder als Raum für studentische Eigeninitiative. Wer Lehre als Ermöglichung von Gestaltungs- und Lernerfahrungen versteht, findet im Makerspace einen Ort, um Lehren und Lernen neu zu denken.