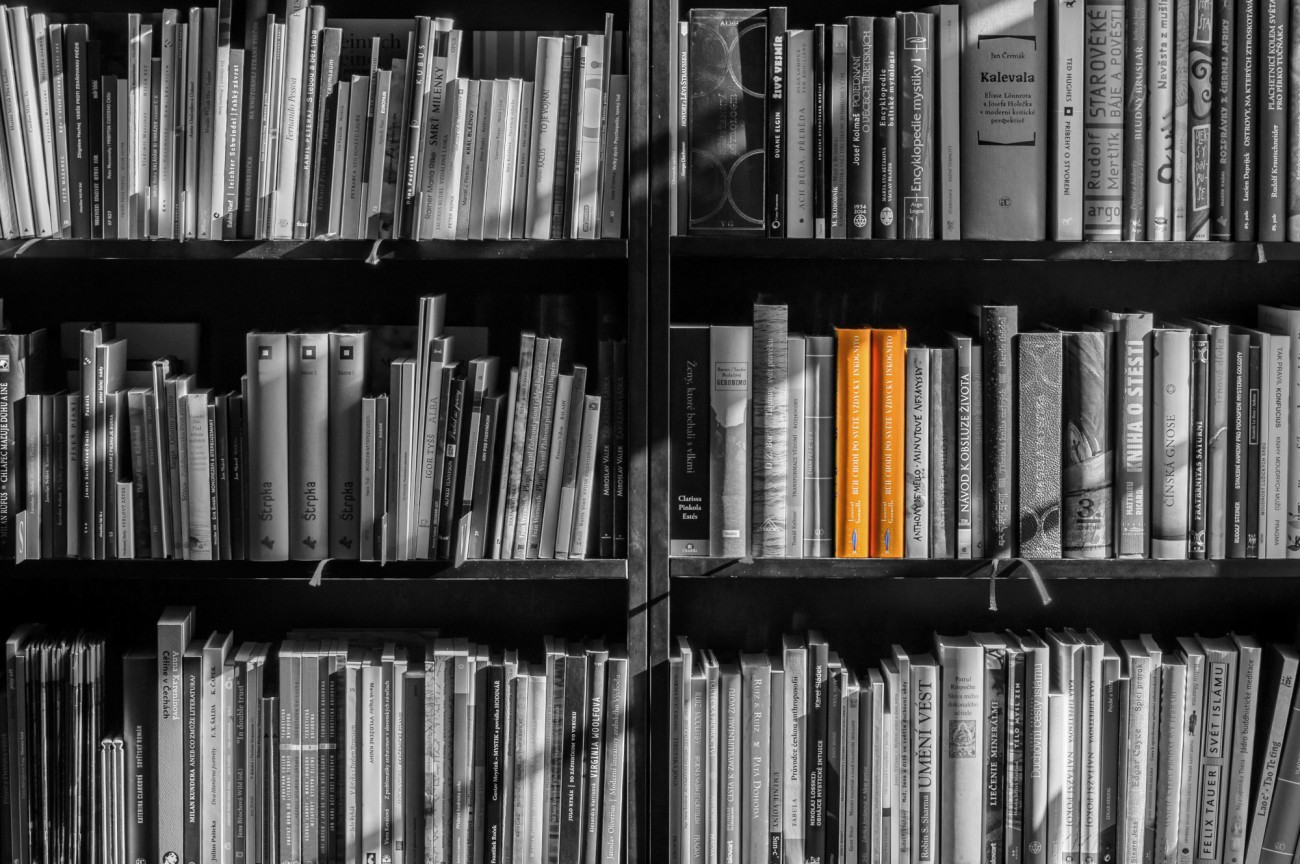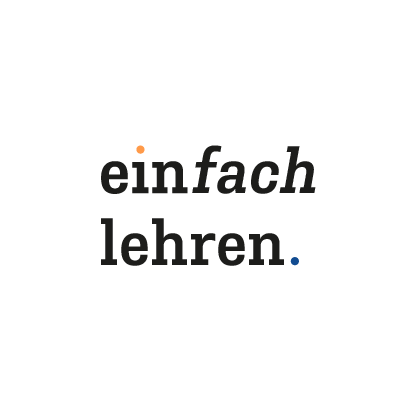Lernumgebungen in den Ingenieurwissenschaften
25.08.2025
Wie technische Lernumgebungen beim Verknüpfen von Theorie und Anwendung in der Lehre genutzt werden.

Im Mittelpunkt der Ingenieurwissenschaften steht die Lösung technischer Probleme – bei der Entwicklung und Realisierung von Produkten, Prozessen oder Systemen. Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge zeichnen sich daher in der Regel durch den Anspruch einer engen Verknüpfung von Theorie und deren Anwendung zur Problemlösung aus. Dieses Spannungsfeld zwischen fundiertem Fachwissen und Anwendungsorientierung setzt besondere didaktische Konzepte voraus, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung von Lernumgebungen.
Der Begriff Lernumgebung ist in der Hochschuldidaktik weit gefasst. Er schließt sowohl das physische und digitale als auch soziale und didaktische Setting ein, in dem Lehren und Lernen stattfindet. (Rusticus et al., 2019)
Im Kontext ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge rücken vor allem Lernumgebungen in den Fokus, die technikgestützt gestaltet sind und praxisnahe Möglichkeiten für handlungsorientiertes Lernen eröffnen. Dieser Beitrag zeigt exemplarisch, welche Prinzipien und Umsetzungsformen sich dabei bewährt haben und wie sie sich in der ingenieurwissenschaftlichen Hochschullehre nutzen lassen. Ziel ist es, Ihnen Impulse und praxisorientierte Hinweise zur Planung und Gestaltung technischer Lernumgebungen zu geben. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz von Technologien, sondern auch um die sinnvolle Einbettung in Lehr- und Lernkonzepte und die Förderung der Motivation der Studierenden.
Prinzipien zur Gestaltung von Lernumgebungen
In der beruflichen Praxis lösen Ingenieur:innen keine idealtypischen Aufgaben auf Papier – sie konstruieren, testen, verbessern, machen Fehler und lernen daraus. Sie arbeiten in interdisziplinären Teams, greifen auf digitale Werkzeuge zurück, agieren in komplexen, dynamischen Umgebungen. Und hier liegt die Herausforderung für die Hochschullehre: Wie lassen sich Lehrveranstaltungen so gestalten, dass Studierende auf diese berufliche Realität vorbereitet werden?
Fachwissen allein führt nicht zur ingenieurwissenschaftlichen Handlungskompetenz. Durch aktives Anwenden, Konstruieren, Experimentieren und Reflektieren können Studierende ein tiefergreifenderes Verständnis technischer Systeme und Prozesse entwickeln.
Problem- und Projektorientierung
Eine erfolgreiche Gestaltung technischer Lernumgebungen basiert auf den Prinzipien der Problem- und/oder Projektorientierung. Beide Konzepte rücken reale oder realitätsnahe Herausforderungen in den Mittelpunkt des Lernens. Während problemorientierte Lehr- und Lernsettings gezielt mit offenen, authentischen Fragestellungen arbeiten, die kognitiv fordernd und mehrdeutig sein dürfen, zielt projektorientiertes Lernen auf die eigenständige, strukturierte Bearbeitung komplexerer Aufgabenstellungen in Gruppen.
‚Hands-on Learning‘
Das Prinzip des praktischen Lernens mit Materialien, Werkzeugen und realen Objekten gilt als lernförderlich, da so konkrete Erlebnisse und Erfahrungen entstehen. Durch aktives Ausprobieren kann ein tiefgreifendes Verständnis entwickelt werden. (Kolb, 2014) Lernprozesse, bei denen Studierende selbst planen, experimentieren, montieren, testen oder simulieren, fördern aber nicht nur fachliches Verständnis, sondern auch Problemlösefähigkeit, Kreativität, Kommunikations- und Teamkompetenz.
Lernen mit realen Kontexten und Ressourcen
Für die Wirksamkeit technischer Lernumgebungen ist Authentizität entscheidend. Lernprozesse sollten in möglichst praxisnahen Kontexten stattfinden (Loyens et al., 2008). Dazu gehört die Einbindung berufsrelevanter Aufgabenstellungen und typischer Arbeitsmittel aus dem Ingenieur:innenalltag wie CAD-Software, SPS-Steuerungen, Robotiksysteme, Werkstoffe oder Prüfstände – je nach Fachdisziplin. So werden abstrakte Fachinhalte greifbar und bedeutungsvoll, was die Anschlussfähigkeit des Gelernten an die Berufspraxis sichert.
Lernumgebungen für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge sollten also so gestaltet sein, dass sie ein ‚doing engineering‘ (Hamming, 1997) ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um technische Ausstattung, sondern auch um exploratives Handeln, Fehlertoleranz und die Realisierung iterativer Verbesserungsprozesse. Lernen findet insbesondere dann statt, wenn Lernende innerhalb realer Aufgaben wiederholt zwischen Theorie und Praxis wechseln – also reflektiertes Handeln üben (Schön, 1983). So wird das Lernen nicht zum bloßen Nachvollziehen technischer Vorgaben und fachliche Inhalte werden nicht losgelöst vermittelt, sondern durch konkrete Problemstellungen motiviert.
Tipp
Bauen Sie in praktischen Aufgaben gezielt Anlässe ein, bei denen die Studierenden noch einmal ‚in die Theorie schauen‘, ihr praktisches Handeln und ihre Ergebnisse damit vergleichen und reflektieren müssen.
Merkmale technischer Lernumgebungen
In ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen nehmen klassische Formate wie Vorlesungen und Übungen, in denen es um theoretische Grundlagen und mathematisch-naturwissenschaftliche Prinzipien geht, viel Raum ein. Doch soll dieses Wissen angewendet werden, stoßen solche rein kognitiven Lehrformate an ihre Grenzen. In technischen Lernumgebungen steht daher handlungsorientiertes Lernen im Fokus. Dabei lassen sich technische Lernumgebungen in drei übergeordnete Kategorien einteilen:
- Physische Lernumgebungen
Klassische Präsenzformate mit realer technischer Ausstattung. Sie ermöglichen die direkte Erfahrung von Materialität, Technik und physikalischen Prozessen und fördern motorische, haptische und soziale Lernprozesse. - Virtuelle Lernumgebungen
Digitale Räume, in denen Experimente, Konstruktionen oder Prozesse simuliert und interaktiv bearbeitet werden. Sie bieten häufig hohe Flexibilität und ermöglichen komplexe Szenarien ohne Sicherheitsrisiken oder auch hohe Materialkosten. - Hybride Lernumgebungen
Kombinationen aus physischen und virtuellen Komponenten. Diese Formate können die Reichweite und Zugänglichkeit technischer Lernangebote erhöhen und flexibilisieren.
Die Auswahl und Gestaltung einer technischen Lernumgebung, egal ob physisch, virtuell oder hybrid, ist keine rein technische, sondern insbesondere eine didaktische Aufgabe und beginnt mit der Identifikation und Formulierung der Lernziele, die adressiert werden sollen. Neben fachlichen Lernzielen wie beispielsweise die fachgerechte und sichere Bedienung von Maschinen oder Software oder auch die korrekte Ermittlung, Dokumentation und Auswertung von (Mess-)Daten, nimmt auch die Bedeutung überfachlicher Lernziele wie beispielsweise Fähigkeiten zur kreativen Problemlösung und Teamarbeit zu.
Die folgenden Leitfragen können Ihnen als Planungs- und Entscheidungshilfe bei der Entwicklung und Gestaltung Ihrer Lernumgebung dienen:
| Merkmal | Leitfragen |
|---|---|
| 1. Lernziele |
|
| 2. Lerngruppe |
|
| 3. Infrastruktur |
|
| 4. Betreuung |
|
| 5. Ressourcen |
|
| 6. Sicherheit |
|
| 7. Flexibilität |
|
| 8. Zugänglichkeit |
|
Lernen in technischen Lernumgebungen
Studierende stehen in technischen Lernumgebungen vor der Herausforderung, sich in für sie oftmals neue Geräte, unbekannte Maschinen und komplexe Systeme einzuarbeiten. Die aufgeführten Leitfragen bilden auch hier einen Rahmen für die Gestaltung eines Einführungs- und Begleitkonzepts. Ziel sollte es sein, nicht nur Sicherheitsregeln und Bedienfertigkeiten zu vermitteln, sondern auch das Verständnis für Funktionsprinzipien und sinnvolle Anwendungsstrategien zu fördern. Mit Blick auf Sicherheitsaspekte, Fehlerfolgen und Kosten, aber auch Komplexität, das Vorwissen der Studierenden und den verfügbaren Zeitrahmen müssen Sie entscheiden, wie stark ein geführtes Vorgehen in Ihrer Lernumgebung erforderlich oder vielleicht auch ein einfaches Ausprobieren möglich ist.
Bei der Wahl der Methode sollten Sie abwägen, wieviel Instruktion nötig und wieviel Exploration möglich ist. Stark strukturierte Anleitungen und Vorgaben bieten zwar Sicherheit und Planbarkeit, können sich aber gleichzeitig negativ auf das Interesse und die Motivation der Studierenden auswirken.
In der Praxis hat sich ein gestuftes Vorgehen bewährt: Zunächst erfolgt eine Sicherheits- und Funktionsunterweisung, je nach Komplexität anschließend ein betreutes Ausprobieren mit der Möglichkeit für Rückfragen und schließlich ein Übergehen zum möglichst selbstständigen Arbeiten, ggf. mit ergänzenden Materialien wie Videos oder Anleitungen.
Sechs bewährte Formate technischer Lernumgebungen
Im Folgenden finden Sie hier exemplarisch einige bewährte Formen und Beispiele typischer technischer Lernumgebungen, die sich in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen etabliert haben.
1. Lernfabriken
Lernfabriken sind realitätsnahe Abbildungen verketteter, industrieller Fertigungs-, Montage- und Logistikprozesse und somit ebenfalls physische Lernumgebungen. Sie stellen reale Miniaturfabriken zur Modellierung industrieller Prozesse dar – häufig auch mit Ansätzen zur Automatisierung und Bezügen zur Industrie 4.0.
2. (Fach-)Labore
Labore sind physische Lernumgebungen für klassische Präsenzformate mit realen Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen, Experimentiersystemen oder Prüfständen. Sie ermöglichen das praktische Erleben physikalischer und technischer Phänomene. (Feisel & Rosa, 2005) Das Setting ist in der Regel sehr strukturiert und in festen, instruktiven Abläufen organisiert.
3. Werkstätten
Werkstätten sind physische Lernumgebung für mechanische, fertigungstechnische, mechatronische oder elektrotechnische Themen. Hier geht es um manuelle oder maschinelle Arbeiten beim Entwickeln, Herstellen und Montieren technischer Objekte mit direkter Rückmeldung aus Material und Prozess.
4. Remote Labs
Als Remote-Labore werden physische Versuche im Modus der Fernansteuerung bezeichnet, bei denen die Durchführung des Versuchs in der Regel über das Internet erfolgt. Remote Labs gelten daher als hybride Lernumgebungen. Dadurch, dass es sich um reale Versuchsaufbauten handelt, besteht (anders als bei reinen Simulationen) die Möglichkeit, dass auch reale, unerwartete Ergebnisse entstehen.
Beispiel: FPGA Vision Remote Lab, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
5. Virtuelle Labore
Virtuelle Labore zeichnen sich dadurch aus, dass sie technische Experimente und Prozesse in computergestützten Simulationen oder webgestützten Systemen abbilden und zugänglich machen. Dadurch ermöglichen sie räumliche sowie zeitliche Flexibilität – beispielsweise als jederzeit verfügbare Simulationsumgebung.
Beispiel: Das virtuelle Technologielabor, Hochschule Kaiserslautern
6. Makerspaces
Makerspaces ähneln Werkstätten und sind ebenfalls physische Lernumgebungen. Sie sind jedoch i.d.R. nicht in abgegrenzten Arbeitsplätzen strukturiert, sondern eine offene, kreative Umgebung. Häufig stehen Handwerkzeuge, Werkzeugmaschinen und insbesondere Prototyping-Tools wie 3D-Druck oder Lasercutter zur Verfügung. Es steht der Erwerb von Wissen im Prozess der Anwendung, insbesondere durch ‚Trial-and-Error‘ im Fokus.
Fazit
Technische Lernumgebungen müssen nicht grundsätzlich aufwändig, teuer oder groß sein. Auch kleine oder dezentrale Formate wie digitale Labore oder bestehende Infrastruktur wie z.B. technische Werkstätten können effektiv als Lernumgebung eingesetzt werden, wenn sie didaktisch gut in entsprechende Lernangebote eingebettet sind.