Wahrnehmungsfehler – Auftreten
21.01.2024
Vorurteile und Bewertungsfehler wie Halo-, Primacy- und Recency-Effekte können durch Bewusstsein für diese Fehler vermieden werden.

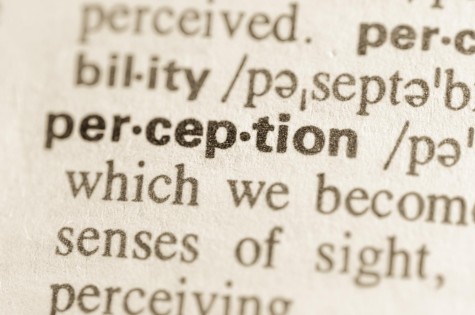
Während Wahrnehmungsfehler auf Fehler im Personenwahrnehmungsprozess zurückzuführen sind und insbesondere bei der Leistungsbeurteilung auftreten, entstehen Beurteilungsfehler bei der abschließenden Leistungsbewertung. Im Folgenden werden jeweils die wichtigsten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler erläutert.
Die wichtigsten Wahrnehmungsfehler
Logischer Fehler: Dieser Fehler entsteht durch eine falsche logische Schlussfolgerung von einer Eigenschaft einer Person auf eine andere Eigenschaft (). Die Erklärungsversuche gehen auf implizite Persönlichkeitstheorien zurück (). Ein Beispiel: Kennen Dozent*innen Studierende aus dem Bachelormodul zur Persönlichkeitspsychologie, in dem Modul sind sie positiv aufgefallen, da sie überdurchschnittlich gute Leistungen erbracht haben. Im Mastermodul zum Thema Statistik unterrichtet sie die Studierenden erneut. Aus seiner hohen Leistung im Bachelormodul folgert sie, dass die Studierenden auch in Statistik glänzen werden. Tatsächlich sind die Fähigkeiten in diesen beiden Bereichen jedoch unabhängig voneinander und die Studierenden zeigen in Statistik nur durchschnittliche Leistungen. Die Dozent*innen beurteilen sie fälschlicherweise besser, als sie eigentlich sind. Im Beispiel liegt ihr die (unbegründete) Annahme zugrunde, dass eine hohe Fähigkeit bereichsübergreifend (fachunspezifisch) ist.
Halo-Effekt: Die Bezeichnung dieses Effekts leitet sich etymologisch vom englischen „halo“ ab, was mit Glorien- oder Heiligenschein übersetzt werden kann. Beim Halo-Effekt überstrahlt ein sehr dominantes Merkmal andere Wahrnehmungseindrücke. Dies können zum Beispiel ein gepflegtes Äußeres oder auch sprachliche Eloquenz sein (Macke et al., 2012). Beispielsweise versucht ein Student den Halo-Effekt auszunutzen, indem er adrett im Anzug zur mündlichen Prüfung erscheint, um einen guten Eindruck zu machen und von seinen Wissenslücken abzulenken.
Vorinformation/Vorurteil: Wie in Klebers Abbildung des Wahrnehmungsvorgangs (Kleber, 1992, S. 111) dargestellt, beeinflussen Vorinformationen unsere Wahrnehmung und richten unsere Erwartungen auf spezifische Aspekte aus, die mit unseren Vorannahmen konsistent sind (Macke, Hanke & Viehmann, 2012). Diese Aspekte werden dann verstärkt wahrgenommen, während andere Informationen, die nicht mit unseren Erwartungen konsistent sind, weniger stark beachtet werden. Dabei können Vorinformationen auch Vorurteile und Stereotype aktivieren, ohne dass uns dies bewusst ist. Betreut man beispielsweise die Masterarbeit einer Studentin, die sich zuvor in einer Vorlesung wiederholt skeptisch geäußert und die Inhalte der Veranstaltung in Frage gestellt hat, nimmt man diese möglicherweise als „notorische*r Nörgler*in“ wahr und achtet auch im Rahmen des Betreuungsprozesses verstärkt auf kritische Äußerungen. Auf der Basis einer solchen Vorinformation verändert sich die zwischenmenschliche Interaktion, sodass ein Pygmalion-Effekt begünstigt wird.
Pygmalion-Effekt: Dieser Effekt wurde nach dem griechischen Mythos um den Bildhauer Pygmalion benannt, der sich eine Frauenstatue nach seinen Wünschen erschafft und zum Leben erweckt. In einer bekannten psychologischen Studie konnten Rosenthal und Jacobson (Rosenthal & Jacobson, 1968) nachweisen, dass sich positive Erwartungen von Lehrkräften über SchülerInnen sogar so weit auswirken können, dass diese deren Verhaltensweisen und Lernleistung beeinflussen. Hierzu wurden den Lehrkräften positive Vorinformationen über zufällig ausgewählte Grundschüler*innen gegeben: Aufgrund eines psychologischen Tests habe man herausgefunden, dass bei diesen Kindern in naher Zukunft ein deutlicher Entwicklungsschub zu erwarten sei. Nach einem Jahr zeigten diese Schüler*innen einen deutlich höheren Zuwachs in ihrem IQ als ihre Mitschüler*innen und wurden von den Lehrkräften positiver beurteilt. Dieser Effekt wurde dadurch erklärt, dass die Lehrkräfte der Entwicklung dieser Schüler*innen positive Erwartungen entgegenbrachten und sie deswegen besonders förderten. Sicherlich kann der Effekt bei negativen Vorinformationen über Studierende auch in die andere Richtung wirken.
Sympathie/Antipathie: Auch die persönliche Sympathie oder Antipathie gegenüber Studierenden kann dazu führen, dass man ihre Leistungen besser oder schlechter bewertet als sie es tatsächlich ist (Macke et al., 2012). Unsympathische Personen werden häufig auch als weniger begabt eingeschätzt. Diese Einschätzung wirkt sich in mündlichen Prüfungen unmittelbar auf die Auswahl der Prüfungsfragen aus, sodass beispielsweise nur relativ leichte Fragen gestellt werden und man Kandidat*innen gar nicht die Chance gibt, ihre Fähigkeiten auch in schwierigeren Bereichen zu demonstrieren (ebenda).
Die wichtigsten Beurteilungsfehler
Primacy- bzw. Recency-Effekt: Bei diesem Fehler werden entweder der erste Eindruck (Primacy-Effekt) oder der letzte Eindruck (Recency-Effekt) stärker gewichtet, wodurch das Urteil verzerrt wird (Macke et al., 2012, S. 140). Nehmen wir als Beispiel eine mündliche Prüfung, in der die Prüfungskandidatin zum Einstieg ein Thema referiert, das sie sehr gut vorbereitet hat und zu dem sie alle Fragen beantworten kann. Die nachfolgenden Fragen zu anderen Themengebieten kann sie jedoch nicht so gut beantworten und zeigt Wissenslücken. Gewichtet die Prüferin/der Prüfer die unterschiedlichen Teile der Prüfung nun nicht gleichwertig, sondern lässt sie/er sich von ihrem/seinen ersten oder letzten Eindruck leiten, werden Primacy- bzw. Recency-Effekte wirksam.
Nähe-Fehler: Dieser Fehler entsteht durch die zeitliche Nähe zweier Ereignisse, wenn das erste Ereignis noch nachwirkt und das sich anschließende zweite beeinflusst, obwohl diese unabhängig voneinander sind (Jürgens & Sacher, 2008). Eine durchschnittliche Leistung in einer mündlichen Prüfung wird daher im Anschluss an eine sehr schlechte Prüfung tendenziell besser bewertet als im Anschluss an eine sehr gute Prüfung. Dies erklärt, warum man auch als Prüfungskandidat/-in lieber im Anschluss an eine/-n leistungsschwache/-n Kommilitonin/Kommilitonen geprüft werden möchte als nach einem besonders starken Kandidaten. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Ereignissen können sich so rhythmische Schwankungen in der Beurteilung ergeben.
Reihungsfehler/rhythmische Schwankungen: Diese Fehlerart ergibt sich durch die direkte Abfolge mehrerer Beurteilungen, die füreinander Referenzpunkte bilden, obwohl ihre Bewertung unabhängig voneinander erfolgen sollte. Sie lässt sich besonders dann gut beobachten, wenn viele Beurteilungen hintereinander vorgenommen werden müssen, z. B. die Korrektur mehrerer Hausarbeiten oder die aufeinanderfolgende Abnahme mehrerer mündlicher Prüfungen. BeurteilerInnen widerstrebt es in solchen Situationen häufig, mehrfach hintereinander eine sehr gute/sehr schlechte Note zu vergeben (Bohl, 2009). Zudem nutzen sie bei der Leistungsbewertung oftmals unbewusst die Leistung derjenigen KandidatInnen als Bezugspunkt, die sie direkt zuvor beurteilt haben (Nähe-Fehler). Als Ursache für Reihungsfehler werden zum einen Wahrscheinlichkeitskalkulationen und Erwartungseffekte als Ursachen angegeben, zum anderen aber auch Schwankungen in Konzentration und Aufmerksamkeit diskutiert (Macke et al., 2012).
Milde- und Strengefehler: Hier geht es darum, dass Beurteilende die grundsätzliche Tendenz zeigen, milde oder strenge Urteile abzugeben (Bohl, 2009). Beispielsweise ist Dozent*in A dafür bekannt, dass er Hausarbeiten wohlwollend benotet (Mildefehler), während Dozent*in B unter den Studierenden gefürchtet ist, da sie nur sehr selten gute Noten vergibt und viele Hausarbeiten nach der ersten Abgabe erneut überarbeiten lässt (Strengefehler). Als Ursache werden unterschiedliche Aspekte diskutiert (Jürgens & Sacher, 2008): Zum einen werden Persönlichkeitsmerkmale als Grund dafür angegeben, dass manche Dozent*innen „Mildbeurteiler“ bzw. „Strengbeurteiler“ (ebenda, S. 74) sind. Andererseits werden auch die Bekanntheit der zu beurteilenden Person durch die Lehrenden oder Sympathie/Antipathie als Auslöser von Milde oder Strenge gegenüber einzelnen Personen angeführt (Bohl, 2009; Kleber, 1992). Hierbei wird angenommen, dass bekannte Personen milder beurteilt werden als unbekannte. Wichtig ist, dass der Versuch, einem Mildefehler vorzubeugen, auch in den Strengefehler umschlagen kann und umgekehrt (Macke et al., 2012, S. 140).
Tendenz zur Mitte/zu Extremen: Bei diesen Tendenzen wird das Notenspektrum nicht voll ausgeschöpft, sondern es werden entweder vorwiegend Noten im mittleren Bereich (Tendenz zur Mitte) oder in den Randbereichen (Tendenz zu Extremen) vergeben. Als Auslöser für die Tendenz zur Mitte wird häufig Unsicherheit angegeben (Bohl, 2009; Macke et al., 2012; Sacher, 2014), sie kann jedoch auch durch eine stärkere Gewichtung mittelschwerer Aufgaben entstehen (Bohl, 2009). Im Gegensatz dazu wird die Tendenz zu Extremen auf eine starke Erregbarkeit bzw. Begeisterungsfähigkeit der Bewertenden zurückgeführt (Sacher, 2014).
Kontrastfehler, Ähnlichkeitsfehler und Fehler gleicher Art: Bei diesem Fehler wird ein (unbewusster) Vergleich zwischen der eigenen Person und der zu beurteilenden Person vorgenommen, der die Grundlage für die Erwartungen bildet (Bohl, 2009; Jürgens & Sacher, 2008). Haben Dozent*innen beispielsweise den Eindruck, dass ein Student ihm zu seinen eigenen Studienzeiten ähnelt, so kann dies bewirken, dass er ihn positiver bewertet als es seiner Leistung angemessen wäre. Im Gegensatz dazu kann ein stark wahrgenommener Kontrast zwischen der eigenen Persönlichkeit und der des Studierenden dazu verleiten, diesen strenger zu bewerten.
Wissen um die Folgen-Fehler: Dieser Fehler greift, wenn eine Bewertung milder ausfällt, da ihre Konsequenzen bekannt sind (Bohl, 2009). Das Wissen um die Tragweite einer Prüfung, zum Beispiel die letzte Chance vor der Exmatrikulation, kann dazu führen, dass man davor zurückschreckt, eine schlechte Note zu vergeben, obwohl diese der Leistung angemessen wäre.






