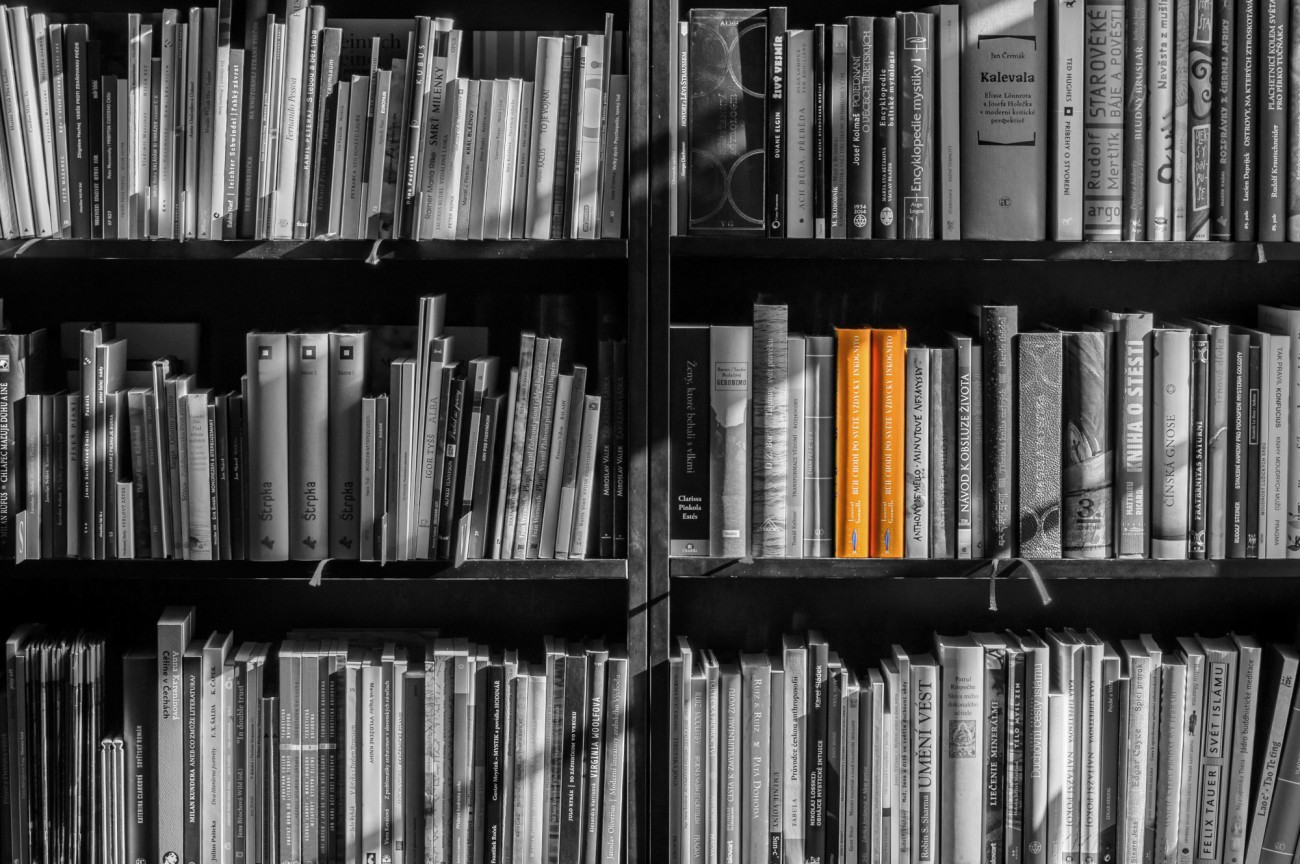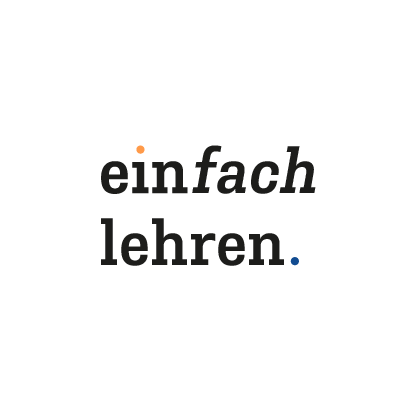Didaktische Planungsprozesse
15.02.2023
Wie kann ich gute Lehre planen?
Constructive Alignment
Shift from teaching to learning
Lehrende unterstützen das Lernen, entscheidend ist letztendlich jedoch, was die Studierenden machen. Entsprechend sollten Lehrende ihren Fokus auf die Aktivitäten der Studierenden richten und nicht auf ihre eigenen Aktivitäten. Hier kommt der „shift from teaching to learning“ ins Spiel.
Doch wie sollte Lehre auf Basis dieser Grundüberlegung sinnvoll geplant werden? Was muss man beachten, um Studierende beim Lernen möglichst gut zu unterstützen? Auf einer grundsätzlichen Ebene ist zur Beantwortung dieser Fragen das Constructive-Alignment-Prinzip sehr hilfreich (siehe auch Abbildung 1). John Biggs (2007) hat hiermit einen Kontext geschaffen, der konkret genug ist, um Lehrenden eine Hilfestellung zu geben und abstrakt genug, um auch unabhängig von Fachkulturen und –inhalten zu bestehen.
Ausgangspunkt des Constructive Alignment
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Studierende ein Lernziel möglichst gut erreichen, wenn ihre Lernaktivitäten möglichst eng mit dem Lernziel in Zusammenhang stehen. Biggs illustriert dies anhand von Lernbeispielen aus der Praxis. So ist intuitiv nachvollziehbar, dass z. B. ein Kind nur dann lernt Schuhe zu binden, indem es selber versucht, Schuhe zu binden (vgl. ebd., 61). Übertragen auf die Lehre an der Hochschule ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, zu überlegen, was Studierende am Ende können sollen, um dann Annahmen darüber zu treffen, was sie in und außerhalb der Lehrveranstaltungen tun müssten. D.h. Lernziele („Intended learning outcomes“) müssen mit den Lernaktivitäten möglichst eng in Einklang gebracht werden („aligment“). „Constructive“ verweist in diesem Zusammenhang auf die Annahme, das Lernen immer bedeutet, eigene Denk- oder Handlungs-Konstrukte zu schaffen (oder zu verändern), was eigene Aktivität erfordert und an bestehende Denkstrukturen anschließt.
Lernziele, Lernaktivitäten und Prüfungen
Im Hochschulbereich sind neben Lernzielen und Lernaktivitäten die Prüfungen der dritte Kernbereich, der unabhängig von Lernzielen und Lernaktivitäten existiert und mit diesen in Einklang gebracht werden muss. Anders als in den meisten Alltags-Lernsituationen soll Hochschullehre auch Leistungen bewerten, um z. B. zu selektieren und die Einhaltung eines bestimmten Lernstandards zu gewährleisten. Das Constructive Aligment-Prinzip bezieht Prüfungen mit ein und betont, dass Prüfungen so ausgestaltet werden müssen, dass diese in der Lage sind, die Lernziele auch abzubilden. D. h. wenn Studierende lernen sollen, ein Konzept auf einen Fall anwenden zu können, dann muss dies in einer Prüfung auch gezeigt werden können, damit überhaupt eine Aussage über das Erreichen des Lernziels möglich ist. Für die Gestaltung der Lehre ergibt sich hieraus, dass die (angereizten) Lernaktivitäten der Studierenden auf die später geforderten Prüfungsleistungen vorbereiten sollten.
Sieben Schritte des Constructive Aligment
Versucht man das Constructive-Aligment-Prinzip auf eine bewährte Vorgehensweise zur Planung von Lehrveranstaltungen herunterzubrechen, so ergeben sich folgende sieben Schritte, an denen man sich orientierten kann:
- Wer lernt? Zielgruppe
- Wozu wird gelernt? Lernziele
- Mit welchem Erfolg wird gelernt? Prüfungen
- Was wird gelernt? Inhalte
- Wie wird gelernt? Methoden
- Womit wird gelernt? Material/Medien
- Wie lehre ich? Evaluation und Reflexion
Innerhalb dieser sieben Schritte ergeben sich didaktisch konzeptionell einige spezifische Herausforderungen, die im Folgenden kurz erläutert werden. Erfahrungen aus der Praxis und Tipps möglichst effizient, Lehre zu planen, finden sich hier.
1. Zielgruppe: Wer lernt?
Eine Zielgruppenanalyse – oder auch Adressatenanalyse genannt – ist wichtig für die Formulierung von Lernzielen, Stoffauswahl und das weitere Vorgehen. Dabei wird unterschieden zwischen der allgemeinen Adressatenanalyse (z. B. 2. Semester im Studiengang XY) und der speziellen Analyse der Studierenden, die tatsächlich in der zu planenden Lehrveranstaltung im aktuellen Semester teilnehmen. Je mehr die Lehrenden über ihre Studierenden wissen, desto besser können sie ihre Lehrveranstaltung an die Zielgruppe anpassen. Dies ist wichtig, weil bei größerer Über- oder Unterforderung kein oder kaum Lernen stattfindet. Es lohnt sich also, möglichst viel im Vorfeld bzw. zu Beginn der Veranstaltung über die Studierenden zu erfahren.
2. Ziele & learning outcomes: Wozu wird gelernt?
Die Formulierung der Ziele einer Lehrveranstaltung oder auch einer Kombination aus verschiedenen Veranstaltungsformen ist einerseits wichtig, weil sich daran die ganze weitere Konzeption der Veranstaltung orientiert, andererseits sind aber auch die „Learning Outcomes“, also das, was die Studierenden nach der Lehrveranstaltung können (sollen), durch die Ziele genau festgelegt – und werden bei einer Lernerfolgskontrolle gemessen.
Bei der Formulierung der Ziele werden drei Arten von Zielen unterschieden, die je nach Fachrichtung und Inhalt unterschiedlich gewichtet sind:
- die kognitiven Ziele,
- die affektiven Ziele und
- die psychomotorischen Ziele.
Bei kognitiven Zielen geht es um Wissen, Daten- und Faktenlernen, Anwenden, Transferleistungen, Problemlösen und Entwickeln neuer Ideen. Aber auch die affektiven Ziele, bei denen es um Einstellungen, Werthaltungen, Motivation und/oder Kritik geht, spielen eine große Rolle, wenn es beispielsweise um Gesprächsführung oder um das Training sozialer Kompetenzen geht. Die psychomotorischen Ziele sind bei der Bedienung von Maschinen (z. B. Praktika, Labore), bei der Beherrschung von Bewegungsabläufen und natürlich im Sport sehr wichtig.
Lernziele / Lehrziele / Learning Outcomes können auf unterschiedlichen Ebenen formuliert werden:
- Makroziele beschreiben die beabsichtigte Learning Outcomes auf Ebene eines Studiengangs
- Mesoziele bezeichnen beabsichtigte Learning Outcomes auf Ebene eines Moduls oder einer Lehrveranstaltung
- Mikroziele formulieren beabsichtigte Learnings Outcomes auf der Ebene einer Lehrveranstaltungseinheit, z. B. eine Vorlesung von 90 Minuten.
Seit der Bologna-Reform im Jahr 1999 wird eine Kompetenzorientierung der Studiengänge gefordert. Dies bedeutet für die Formulierung von Lernzielen, dass nicht nur Wissen angeeignet werden soll, sondern auch Können der Studierenden angestrebt werden muss. In der universitären Praxis ist für viele Kompetenzen eine Wissensbasis nötig, so dass in der Praxis in vielen Vorlesungen Ziele im Bereich Wissen angestrebt werden. Dieses Wissen steht dann in Übungen und anderen Lehrformen wie Praktika, Seminaren und Projekten zur Verfügung. In solchen Lehrveranstaltungen können Kompetenzen entwickelt werden, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen situative Anforderungen bewältigt werden können. Das im Bologna-Prozess außerdem geforderte Abgleichen (constructive alignment) bedeutet Kongruenz von Lehre und Prüfung (Zielen und Formen) (Biggs & Tang, 2007):
- Beabsichtigter Lernerfolg (ILO – intended learning outcomes)
- Lehrende-/Lernende-Aktivitäten (TLA – teaching/learning activities)
- Zu beurteilende Aufgaben (AT – assessment tasks)
Tipp: Formulieren Sie Ihre Ziele so, dass Sie sie auch beobachten können. Überlegen Sie bei der Formulierung der Ziele gleich, welche Prüfungsformen Sie wählen, damit Sie die Ziele auch prüfen können.
Beispiel: Sie möchten die erfolgreiche Gesprächsführung in Mitarbeitergesprächen lehren und prüfen, dann sollten Sie die Gesprächsführung auch in einem Gespräch prüfen und nicht in einer Klausur Wissensfragen dazu stellen. Sie können beobachten, wie die Begrüßung gestaltet ist, wie die Problemdarstellung erfolgt usw. Entsprechend formulieren Sie die Ziele.
3. Prüfungen: Mit welchem Erfolg wird gelernt?
Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Prüfungen und Prüfungsvorleistungen bedarf zunächst der gründlichen Analyse der rechtlichen Grundlagen aus Hochschulgesetzen, aktuellen Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Lernziele in den Modulbeschreibungen des Studienganges.
Für die optimale Vorbereitung einer Prüfung gilt es nicht nur, die Prüfungsform, die Fragen und die Bewertungskriterien festzulegen, sondern auch die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten schon zu Beginn der Lehrveranstaltung umfassend zu informieren, was von ihnen erwartet wird.
Wichtig ist die Abstimmung der Ziele der Lehrveranstaltung bzw. des Moduls mit der angemessenen Prüfungsleistung. Welche Kompetenzen sollen die Studierenden am Ende der Lehrveranstaltung entwickelt haben und in welcher Form können sie diese erworbenen Kompetenzen in einer Prüfungssituation zeigen?
Tipp: Nehmen Sie Ihre Ziele für die Lehrveranstaltung zur Hand und prüfen Sie, wie Sie diese beobachten und bewerten können. Je genauer Sie die Ziele formuliert haben, desto leichter fällt jetzt die Auswahl der Prüfungsmethode. Informieren Sie Ihre Studierenden früh im Semester über die Prüfungsmethode und führen Sie nach Möglichkeit Probeaufgaben bzw. Probesituationen durch. So stellen sie sicher, dass Sie den Inhalt Ihrer Lehre und nicht die Stressfestigkeit Ihrer Studierenden prüfen.
Beispiel: Wenn eines Ihrer Ziele hieß, die Studierenden sollen eine bestimmte Maschine bedienen können, so müssen Sie diese Bedienung in der Prüfung beobachten und bewerten können. Ein bloßes Auswendiglernen der Bedienschritte reicht nicht aus (wäre aber leicht in einer Klausur abzufragen). Wenn Ihre Studierenden einen Versuch durchführen müssen, sind der Umgang und die Auswertung der Messergebnisse wichtig. Das lässt sich mit einem Fallbeispiel in einer Klausur umsetzen.
4. Inhalte: Was wird gelernt?
Für die Auswahl der Lehrinhalte für die Lehrveranstaltung ist zunächst die fachwissenschaftliche Analyse nötig: Was gehört alles in dieses Fachgebiet und zu diesem Thema? Natürlich können nicht alle nach fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten gesammelten Inhalte in einer Lehrveranstaltung bearbeitet werden, deshalb folgt jetzt die Auswahl und Aufbereitung der Lehrinhalte nach didaktischen Gesichtspunkten.
Die didaktische Analyse der Lehrinhalte bzw. didaktische Aufbereitung der Lehrinhalte umfasst drei Schritte: Zunächst werden die Inhalte ausgewählt und die Auswahl begründet (d. h. warum sind diese Inhalte wichtig für das Erreichen der Lernziele in dieser Lehrveranstaltung?), im zweiten Schritt erfolgt die Anordnung der Inhalte und damit die Strukturierung der Lehrveranstaltung nach didaktischen Prinzipien. Im dritten Schritt erfolgt die didaktische Reduzierung, d. h. die Adaptierung auf die gegebenen Rahmenbedingungen wie Zeit, Ort, Anzahl der Studierenden usw.
Tipp: Machen Sie zunächst ein Brainstorming, was alles zum Themengebiet gehört. Wählen Sie dann aus, was als Muss-, Soll oder Kann-Inhalt entsprechend der Lehr-/Lernziele und der Prüfung angeboten werden soll. Verteilen Sie zunächst die Themen auf die konkret im Semester zur Verfügung stehenden Lehrveranstaltungen (Achtung: im Sommersemester ist ein Donnerstag wegen der Feiertage besonders problematisch) und planen Sie dann erst die einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten. (Checklisten dazu gibt es bei www.Lehridee.de).
Eine gute Vorbereitung und eine sorgsame Planung sind wichtig. Durch Zeitpuffer und Inhaltsbausteine, die gegebenenfalls entfallen oder zusätzlich eingefügt werden können, hält man sich flexibel.
Beispiel: Wenn Sie Projektmanagement als Thema Ihrer Lehrveranstaltung haben, verteilen Sie die Themengebiete auf die Zeit im Semester (z. B. Einführung in das Projektmanagement, Phasen und Meilensteine, Teamentwicklung, Tools für die Projektsteuerung, usw.) Gehen Sie dann an einem Beispiel ein ganzes Projekt durch und verwenden Sie andere Tools, andere Teamtheorien usw., wenn Sie dazu noch Zeit haben. Wichtig ist ein kompletter Projektdurchlauf, den die Studierenden erleben können.
5. Lehrformate & Methoden: Wie wird gelernt?
Für die angemessene Gestaltung der Lehrveranstaltung bietet sich eine Vielfalt von Methoden an, die von rein darbietenden Lehrformen wie Vortrag, Präsentation oder Filmvorführung bis zu sehr aktivierenden und selbstverantwortlichen Lehrformen wie Gruppenarbeit und Projekt reicht. Wichtig ist für die optimale Gestaltung die richtige Methodenauswahl bzw. die Kombination aus verschiedenen Methoden, die zu Abwechslung führt.
Eine Vorlesung kann, wenn sie nach den Erkenntnissen der Lernpsychologie gestaltet ist, sehr anregend und lernförderlich sein. Durch Medien- und Methodenwechsel kann die Aufmerksamkeit über die erwiesenen 20 Minuten hinaus erhalten bleiben und durch Beispiele, Zusammenfassungen, Wiederholungen und einen eindeutigen roten Faden bleibt ein Vortrag zuhörerfreundlich.
Aktivierende Lehrveranstaltungen nutzen verschiedene Methoden wie Gruppenarbeit, Fallbearbeitung, Projekt- und Problemorientierung usw. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die optimale Vorbereitung durch den/die Lehrende/n, dessen Rolle in der Lehrveranstaltung selbst eher die des Moderators/der Moderatorin ist.
Methoden und Sozialformen sollten angemessen ausgewählt werden, d. h. die räumliche Ausrichtung und die optimale Arbeitsform. Gruppenarbeiten sind im Hörsaal nur sehr eingeschränkt möglich, für ein Gespräch müssen sich die Teilnehmenden anschauen können usw. Die Rahmenbedingungen im Hochschulalltag spielen auch hier bei der Ausstattung der Räume eine wichtige Rolle.
Tipp: Aus der Vielzahl an Methoden (z. B. unter Lehridee Methodenglossar oder unter Methodensammlung der HDA (wird in neuem Tab geöffnet)) suchen Sie sich die Methoden aus, die zu Ihrem Fach und zu Ihnen persönlich passen.
Beispiel: Wenn Sie verschiedene Techniken zum Ziel-, Zeit- und Selbstmanagement darstellen und vergleichen möchten, definieren Sie zunächst den Begriff und lassen dann die Studierenden jeweils eine Technik erarbeiten, anstatt alle selbst vorzustellen. In einer anschließenden Präsentation und vergleichenden Diskussion erarbeiten Sie gemeinsam mit den Studierenden die Unterschiede. Dies kann auch mithilfe eines Gruppenpuzzles erfolgen, was Abwechslung zu Referaten bietet.
6. Medienwahl & neue Medien: Womit wird gelernt?
Der Medieneinsatz in der Lehre reicht von der Unterstützung der Informationsvermittlung der Lehrenden in der Präsenzlehre über die Angebote für das Selbststudium bis hin zur virtuellen Kommunikation und Kollaboration. Je nach Ausmaß des didaktisch angemessenen Medieneinsatzes müssen die Ziele, Inhalte und Methoden neu geplant und überdacht werden, weil die Möglichkeiten der digitalen Medien auch die Methoden und Vorgehensweisen in der Lehre beeinflussen. Dies gilt besonders für das Selbststudium sowie die Kommunikation und Zusammenarbeit im virtuellen Lernraum als Begleitung zu einer Lehrveranstaltung oder eines Projektes. Lernplattformen (oder auch Lernmanagementsysteme genannt) bieten Unterstützung bei der Verwaltung der Lehrmaterialien, der Verteilung an die Studierenden, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten, Wikis, Blogs etc. und bieten Kommunikationswerkzeuge für die synchrone und asynchrone Verständigung einzelner und ganzer Gruppen.
Tipp: Wählen Sie die Medien aus, die zum Thema, den Methoden und Lernzielen passen. Eine Bildschirmpräsentation ist nicht immer das Allheilmittel. Probieren Sie eine gemeinsame Erarbeitung, die vor den Augen der Studierenden entsteht und damit auch einen gemeinsamen Lernprozess visualisiert. FlipCharts und Tafeln können heute abfotografiert werden und erleichtern so auch die Dokumentation.
Beispiel: Zum Abschluss einer Lehreinheit fassen nicht Sie die Inhalte (bzw. die Prüfungsrelevanten Inhalte) zusammen, sondern lassen die Studierenden (arbeitsteilig in Gruppen) ein MindMap oder eine kognitive Landkarte über ein Thema anfertigen, was anschließend im Plenum diskutiert wird. So haben die Studierenden eine selbst entwickelte Zusammenfassung und tauschen diese garantiert untereinander aus.
7. Evaluation & Reflexion: Wie lehre ich?
Die Reflexion über die eigene Lehre und das Feedback der Studierenden in der Lehrveranstaltung tragen zur Verbesserung der Qualität der Lehre bei. Evaluationsbögen und Fragebögen, meistens allgemein für die ganze Hochschule von der Qualitätsentwicklungsabteilung eingesetzt und ausgewertet, sind ein Baustein; es gibt aber verschiedene Möglichkeiten und Methoden, unabhängig davon zeitnah Feedback einzuholen und die Anregungen noch im selben Semester umzusetzen. Eine sorgfältige Analyse von eingereichten Hausaufgaben oder Prüfungsergebnissen, ist der zweite wichtige Baustein für die Reflexion der Effektivität der eigenen Lehre. Mithilfe dieser Analyse kann herausgefunden werden, was gut oder weniger gut verstanden wurde, wo noch Fehlkonzepte existieren und wie gut es gelungen ist, Studierende zum selbstgesteuerten Lernen anzuregen. Auf dieser Basis können Rückschlüsse für eine Verbesserung der Lehrveranstaltung gezogen werden.
Tipp: Fragen Sie Ihre Studierenden regelmäßig was gut war und was Sie ändern sollten. Methoden wie das 5-Finger-Feedback oder das One-Minute-Paper sind schnell eingesetzt und schnell ausgewertet. Lesen Sie sich die Anmerkungen in Ruhe durch und reagieren Sie in der nächsten Lehrveranstaltung mit Fragen usw. Sie signalisieren den Studierenden so, dass Sie es ernst nehmen, auch wenn Sie sicher nicht alles umsetzen können.
Hilfreich ist außerdem sich nach jeder Lehrveranstaltungseinheit kurze Notizen zu machen, was an der Planung gelungen ist und was nicht geklappt hat. Auf diese Notizen kann auch zurückgegriffen werden, wenn Sie die Lehrveranstaltung nochmals halten.
Verbessern Sie die Lehrveranstaltung auf Grundlage dieser Rückmeldungen, ihrer eigenen Beobachtungen und der Analyse der Prüfungsergebnisse.
Abschließend zwei aktuelle Aussagen über die Lehre von heute:
„Lehre ist keine Dienstleistung der Lehrenden, sondern ein gemeinsam gestalteter Lernprozess“ (Bartosch, 2017), also keine Ansammlung von prüfungsrelevanten Inputs.
Wir möchten, dass die Studierenden möglichst viel und gut lernen, aber auch, dass wir mit unseren Lehr-Ressourcen auskommen (Edström, 2016). Wichtig ist die Zeit, die wir mit unseren Studierenden verbringen und nicht die Zeit, die wir zur Vor- und Nachbereitung verwenden.