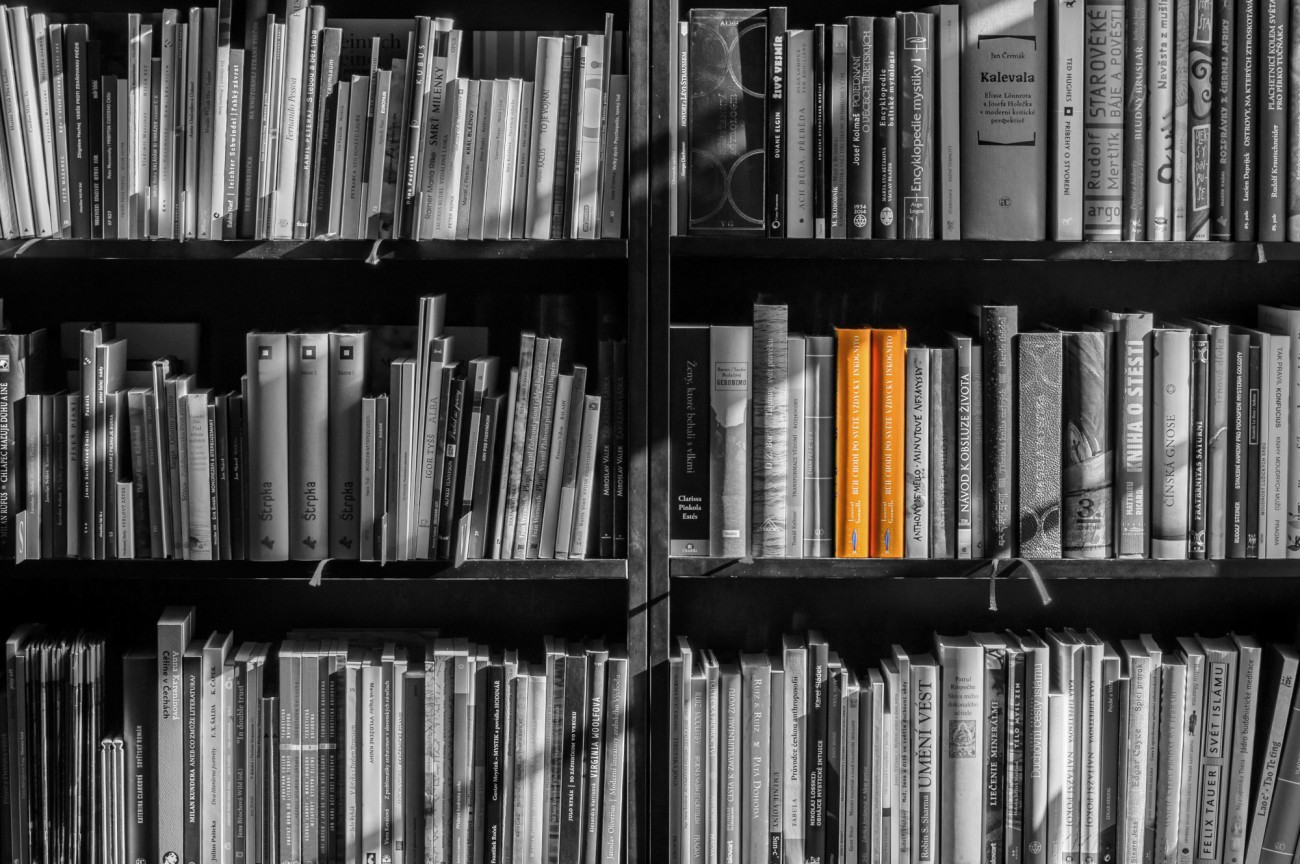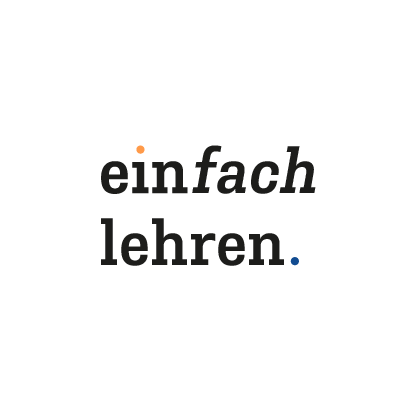Abschlussarbeiten kompetent betreuen
20.11.2023
Erfolgreiche Betreuung in 9 Phasen – von der Themenfindung bis zum Feedback. So gelingt eine strukturierte und unterstützende Betreuung von Abschlussarbeiten.

Welche Aufgaben haben Betreuer_innen?
Die Studierenden bei einer Abschlussarbeit zu begleiten, kann eine wunderbare Erfahrung sein. Betreuer_innen sollten sich aber ganz klar darüber sein, dass eine Abschlussarbeit die Arbeit der Studierenden ist. Das heißt, Studierende schreiben die Arbeit und tragen die Hauptverantwortung, ob sie gut oder schlecht wird. Otto Kruse zum Thema: „Schreiben zwingt dazu, selbständig zu werden.“ (2007, S. 10).
Betreuer_innen sollten sich Gedanken machen, welche Aufgaben zum Betreuungsauftrag gehören und sich ganz klar darüber sein, dass eine Abschlussarbeit die Arbeit der Studierenden ist, das heißt sie schreiben die Arbeit und sie tragen die Hauptverantwortung für die Qualität der Arbeit. Zu den Aufgaben, die Betreuer_innen erfüllen sollten, gehören:
- Die eigenen Erwartungen an die Studierenden kommunizieren und deren Aufgaben klären (ggf. schriftlich, was auf lange Sicht Zeit spart)
- Die Erwartungen der Studierenden erfragen und mit den eigenen Erwartungen abgleichen
- Vorkenntnisse der Studierenden abklären und einschätzen, wie viel diese wissenschaftlich leisten können
- Themen vergeben, die realistisch und machbar sind
- Den organisatorischen und zeitlichen Ablauf planen und dabei folgendes beachten:
- Betreuer_innen sollten nicht über Gebühr belastet werden
- Betreuer_innen sollten in der Bearbeitungszeit für die Studierenden erreichbar sein
- Die Betreuung sollte in die Arbeitsabläufe der Betreuer_in und der Arbeitsgruppe passen
- Den Studierenden Feedback geben
- Beistand und Unterstützung im Projekt bieten
Falls das Ausmaß der Unterstützung nicht in die Bewertung einfließen darf, sollten Betreuer_in genau überlegen, wie weit sie in der Hilfestellung gehen können und wollen, so dass die Arbeit am Schluss noch die Abschlussarbeit der Studierenden ist
Welche Rollen haben Betreuer_innen?
Die Betreuung von Abschlussarbeiten erfordert eine Vielfalt von Aktivitäten und Rollen. So sind Betreuer_innen sowohl Expert_innen für das Thema bzw. Fach, als auch Berater_innen, Supervisor_innen, Coach, LernCoach oder Mentor_innen (für eine Beschreibung dieser verschiedenen Rollen vgl. Begriffsklärungen im Kontext von Beratung und Begleitung von Studierenden an der Universität).
Das Integrated competing values framework versucht, für die vielen verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben von Betreuer_innen einen konzeptionellen Rahmen zu bieten (Vilkinas, 2008). Das Modell unterscheidet sechs – teils paradoxe – Rollen, vgl. Abb. (1). Alle diese Rollen werden – je nach Studierenden (z. B. chaotisch vs. strukturiert oder hinweissensibel vs. hinweistaub, vgl. Delamont et al. 2004, S. 44 ff) – wechselnd im Betreuungsprozess gebraucht. Die explorative Studie von Vilkinas (2008) zeigt, dass eine Mehrheit der interviewten Betreuer_innen sich auf die Rollen Developer (u. a. persönliche Entwicklung der Studierenden fördern) und Deliverer (u. a. Ziele etc. setzen) fokussiert. Auch die Monitorrolle (den Fortgang der Arbeit kritisch überprüfen) wird von einigen noch eingesetzt. Als Broker (u. a. Infrastruktur zur Verfügung stellen) und Innovator (den Betreuungsprozess im akademischen Umfeld kreativ neu denken) werden kaum eingenommen und die Integratorrolle gar nicht. Diese wäre jedoch ausgesprochen wichtig, weil sie beinhaltet, die eigene Betreuung kritisch zu reflektieren und den Gegebenheiten anzupassen. Betreuer_innen sollten sich aber nicht nur die Vielfalt der Rollen, die sie bei der Betreuung innehaben, klar machen. Sie sollten auch überlegen, ob sie bereit und in der Lage sind, alle Rollen erforderlichenfalls zu übernehmen oder wo ihre Grenzen sind und sie Studierende an andere Stellen verweisen würden, die professionelle Hilfe bieten. Zu diesen Stellen zählen z. B. das SchreibCenter oder auch die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks.
Welche Phasen der Betreuung gibt es?
1. Klärungsprozesse vorab
Vor dem ersten Gespräch mit den Studierenden sollten die Vorgaben der Prüfungsordnungen, den Ausführungsbestimmungen oder auch dem Modulhandbuch und des Fachs, der Arbeitsgruppe und der Vorgesetzen bekannt sein. Ein genauer Blick in diese Dokumente lohnt auch, um zwischen Bachelor- und Masterarbeiten differenzieren zu können. Meist sollen Studierende mit ihrer Arbeit aber auch weitere Fertigkeiten und Kompetenzen unter Beweis stellen, die so nicht in den offiziellen Dokumenten genannt werden. Dazu zählen etwa Planungskompetenz, klare Argumentation und Selbstorganisation. Falls es in den offiziellen Dokumenten keine Angaben gibt, sollten sich Betreuer_innen unbedingt im Fachbereich/Institut/der Arbeitsgruppe erkundigen, was die Gepflogenheiten und Vorgaben in Ihrem Bereich sind.
Außerdem ist es hilfreich, sich Gedanken über das eigene Rollenverständnis und die eigenen Erwartungen zu machen. Falls es vom Fachbereich keinen Bewertungsbogen für die Benotung gibt, sollte ein solcher Bogen vor Beginn der Betreuung entworfen werden. Hierbei kann es hilfreich sein, Rücksprache mit Kolleg_innen zu halten, um so ein Gespür dafür zu entwickeln, wie Betreuung und Bewertung im jeweiligen Fachbereich oder Arbeitsgebiet gehandhabt wird. Falls es im Fachbereich keine klaren Hinweise auf die Formalia gibt, sollten Betreuer_innen ein eigenes Style Sheet entwerfen oder Hinweise auf ein im Fach weit verbreitetes Zitations- und Style Sheet geben. Die Studierenden wissen dann, woran sie sind und es gibt einen klaren gemeinsamen Bezugspunkt. „Machen Sie es, wie Sie möchten, Hauptsache einheitlich.“ ist für die Studierenden überhaupt nicht hilfreich und für Bewerter_innen ausgesprochen frustrierend.
2. Thema definieren
Falls Themen vorgegeben werden, sollten diese vorab definiert und gegebenenfalls ausgeschrieben werden. Die zentrale Rahmenbedingung hierfür ist die Anzahl der ECTS Punkte bzw. die Zeit, die für die Bearbeitung der Abschlussarbeit laut Prüfungsordnung vorgesehen (1 ECTS ≙ ca. 25-30 Stunden Arbeit) ist. Um ein geeignetes Thema zu definieren empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
- Auflisten von potentiellen Themen
- Grobe Literaturrecherche für jedes Thema und Auflistung der großen Aufgaben in Zusammenhang mit diesem Thema
- Abschätzung der Zeit, die Betreuer_innen zum Recherchieren, Lesen, Forschen, …. und Schreiben brauchen würden. Wenn diese Zeit etwa ein Drittel der Zeit beträgt, die für die Studierenden zur Anfertigung der Abschlussarbeit zur Verfügung steht, ist das Thema machbar.
- Anfertigung der Ausschreibung mit Angabe des Themas und der vorausgesetzten Kenntnisse und Fertigkeiten.
- Prüfung der Ausschreibung durch Kolleg_innen und / oder Chef_in: ist es machbar, klar beschrieben, attraktiv?
3. Erste Gespräche mit den Studierenden
Viele wichtige Aspekte der Betreuung sollten bereits in den ersten Gesprächen, vor Beginn der Betreuung mit den Studierenden geklärt werden. Damit nichts vergessen wird, ist es sinnvoll, sich hierfür eine Checkliste zu erstellen. Folgende Punkte sollten Betreuer_innen mit den Studierenden vor Beginn der Betreuung klären:
- Erwartungen, wie z. B.: Wieviel und welche Unterstützung wird angeboten? Was müssen Studierende leisten? Gibt es methodische Hilfestellung? Wird Literatur bereitgestellt oder müssen die Studierenden diese selbst finden? Welcher Hard- und Softwaresupport wird zur Verfügung gestellt? Werden Sprach- und Tippfehler von den Betreuer_innen korrigiert?
- Organisation der Beratung: Wann und wie oft? Gibt es festgelegte regelmäßige Treffen? Was wird besprochen? Was sollen die Studierenden für Gespräche vorbereiten? Wer protokolliert die Gespräche?
- Nach der Einschätzung der Studierenden das Thema festlegen
4. Startpunkt für Sturktur und Einschätzung: Das Exposé
Falls die Fähigkeiten der Studierenden unbekannt sind, sollten Betreuer_innen unbedingt versuchen, deren wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben einzuschätzen und herauszubekommen, wieviel Erfahrung die Studierenden mit der Technik und den Methoden haben, die sie für ihre Abschlussarbeit benötigen. Hierzu eignet sich z. B. die Rezension eines aktuellen Artikels oder das Verfassen eines Exposees (vgl. Knigge-Illner 2002, S. 105 ff., Stickel-Wolf & Wolf 2005, S. 117 ff.). Vor allem das Exposee hat den Vorteil, dass Studierende nicht nur ins Schreiben kommen, sondern dass sie sich auch einen klaren Plan über ihre Arbeit machen müssen. Betreuer_innen haben hierbei schon die Möglichkeit zu erkennen, wieviel wissenschaftliches Gespür die Studierenden entwickelt haben und/oder ob ihnen unnötige, aber häufige Fehler wie das Zitieren v. a. populärwissenschaftlicher Quellen oder z. B. eines sozialpsychologischen Artikels für linguistische Fakten unterlaufen.
Die Betreuer_innen sollten das Exposee ausführlich mit den Studierenden besprechen (siehe Abschnitt Feedback geben). Wenn durch dieses Dokument deutlich wird, dass Student_innen inhaltliche oder methodische Defizite haben, müssen diese deutlich angesprochen werden. Es muss geklärt werden, ob und wie diese aufgearbeitet werden können. Falls eine Aufarbeitung nicht möglich ist, sollte ein anderes Thema vergeben werden. Falls das nicht geht, z. B. wegen mangelnder Sprachkompetenz, müssen die Studierenden ganz klar wissen, dass sie hier ein (potentielles) Problem haben.
Enthält die Abschlussarbeit praktische Anteile, können die Betreuer_innen Hinweise auf die Fertigkeiten der Studierenden bekommen, indem sie diese z. B. vorab einen Versuch planen lassen. So können die Studierenden zeigen, ob sie klare Vorstellungen von den Methoden und Abläufen der experimentellen Arbeit haben.
Wenn die Betreuer_innen auf die Ergebnisse der Abschlussarbeit für die eigene Arbeit angewiesen sind, ist es besonders wichtig, das Potential der Studierenden vor Vergabe des Themas einzuschätzen. Schwache Studierende sollten nur solche Themen bekommen, bei denen niemand auf die Ergebnisse angewiesen ist. Betreuer_innen sollten auch kritisch überlegen, ob sie selbst in diesen Bereichen genug wissen und damit Unterstützung bieten können oder ob Kolleg_innen eventuell besser betreuen könnten.
5. Organisation unterstützen
Betreuer_innen sollten die Studierenden von Anfang an zum Planen anhalten, so wird es zum einen leichter, den Überblick zu behalten und die (über)große monolithische Aufgabe in kleinere, bewältigbare Arbeitspakte aufzuteilen. Sehr nützlich für die Strukturierung und Organisation von wissenschaftlichen (Schreib )Projekten sind folgende Werkzeuge:
- Text-/Thesenplan: Studierende überlegen, welche Abschnitte bzw. Kapitel ihre Arbeit enthalten sollte, und schätzen den Platzbedarf und die benötigte Arbeitszeit (vgl. Abbildung 2: Text- bzw. Thesenplan).
- Arbeitsplan/to do Liste: Dieser Plan sollte vom Abgabetermin her rückwärts ausgefüllt werden. Er sollte nicht zu große Arbeitspakete wie z. B. „Arbeit schreiben“ enthalten, sondern kleinere und überschaubare Arbeitspäckchen, wie z. B. „Text abc zusammenfassen“. Der Arbeitsplan sollte auch benötige Ressourcen auflisten, so werden Abhängigkeiten deutlich (vgl. Abbildung 3: Arbeitsplan bzw. To Do-Liste).
- Fortschrittsplan: gibt einen Überblick über den Zustand der Arbeit. Für einzelne Kapitel der Arbeit können hier z. B. folgende Zustände unterschieden werden: Entwurf, Überarbeitung, zum Korrektur lesen gegeben, Korrekturen eingegeben. Es ist sinnvoll, ihn auszudrucken und im Sichtfeld am Arbeitsplatz aufzubewahren und immer am Tagesende zu kennzeichnen, was geschafft wurde (vgl. Abbildung 4: Fortschrittsplan).
- Ganttgrafik: Eine Ganttgrafik kombiniert eine Auflistung der Arbeitspakte und Meilensteine mit einem zeitlichen Überblick über die Arbeitsschritte. Der Vorteil dieses Plans ist, dass zeitliche Engpässe gut identifiziert werden können. Eine Ganttgrafik lässt sich mit Excel erstellen, es gibt aber auch viele (kostenlose) Tools im Internet, die auf Gantt spezialisiert sind (vgl. Abbildung 5: Ganttgrafik).
- Superbuch oder Schreibjournal: Ein sehr hilfreiches Werkzeug zum Selbstmanagement und damit auch zur Organisation eines größeren Schreibprojekts. Ein Superbuch ersetzt sämtliche Notizzettel, Post-its, Schmierzettel und diverse Notizblöcke, ein Schreibjournal alle Notizen auf diversen Medien zum Schreibprojekt. Bei empirischen Arbeiten müssen die Studierenden oft ein Laborjournal führen. Optimalerweise sollte man hier eine Möglichkeit finden, wie die formalen Vorgaben für das Journal mit den Vorteilen eines Superbuchs kombinieren lassen, dass die Studierenden wirklich alle Ideen, Daten und Materialien zu ihrem Projekt an einer Stelle habe. Dies geht eventuell besonders gut in elektronischer Form. Es gibt diverse Tools, die eine solches Superbuch auch auf dem PC oder Tablet ermöglichen (vgl. Abbildung 6: Superbuch oder Schreibjournal).
- Literaturverwaltungsprogramme: Betreuer_innen sollten ihre Kandidat_innen darauf hinweisen, wie hilfreich solche Programme für die Erfassung, Organisation und Formatierung von Literaturangaben sind. Bekannte Programme können teils kostenlos über die Universitätsbibliotheken genutzt werden. Die ULB der TU Darmstadt bietet regelmäßig Kurzworkshops an, um Literaturverwaltungsprogramme- kennenzulernen.
6. Feedback geben
Feedback ist einer der wichtigsten Faktoren im Lernprozess (vgl. Hattie 2009, 2012). Entsprechend ist Feedback zum Arbeitsprozess und zu ersten Schreibprodukten in der Betreuung von Abschlussarbeiten essentiell. Gutes, d. h. faires und wertschätzendes aber auch ehrliches Feedback bietet die Chance für tiefgreifendes Lernen und kann motivieren. Es unterstützt zudem die Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung bei den Studierenden. Im Detail unterscheiden sich vorgeschlagene Feedbackregeln (vgl. Brown 2015, S. 132 ff., Peterßen 2005, S. 95 ff., Ulrich 2015 S. 158 ff.). Essentiell ist auf alle Fälle eine wertschätzende Haltung, das klare Bewusstsein, dass sich Feedback auf eine bestimmte Arbeit bezieht, nicht auf die Person und dass es Sache der Feedbackempfänger_innen ist, zu entscheiden, ob sie das Feedback annehmen und welche Schlüsse sie daraus ziehen.
7. Hilfestellung leisten
Zur Unterstützung der Studierenden sollten Betreuer_innen nach und nach von minimaler zu maximaler Intervention reagieren. Das heißt zunächst die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem oder eine Schwachstelle gibt. Falls sie darauf nicht reagieren, sollten die Betreuer_innen sie motivieren, das Problem selbst zu beheben und Feedback zu den Ideen der Studierenden geben. Falls keine Ideen kommen, geben die Betreuer_innen strategische Information (z. B. „bei dieser Frage könnte es hilfreich sein, nochmal das Methodenhandbuch xy zu Rate zu ziehen“) und fragen nach den nächsten Arbeitsschritten. Der nächste Interventionsschritt der Betreuer_innen wäre, detailliertere Hinweise und mehr Hintergrundinformation zu geben. Erst als allerletzten Schritt sollte eine Problemlösung vorgeschlagen oder vorgemacht werden (vgl. Aebli 1983).
8. Unterstützung im Schreibprozess
Die meisten Studierenden neigen dazu, die Komplexität und den Zeitbedarf des Schreibrozesses zu unterschätzen. Eine Aufgabe von Betreuer_innen ist es daher, die Studierenden frühzeitig zum Schreiben zu animieren und immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Schreiben ein (manchmal langwieriger und sperriger) Prozess ist. Dies ist u. a. auch dadurch bedingt, dass das Schreiben an sich eine klärende Funktion hat. Was aufgeschrieben wird, muss genauer und detaillierter durchdacht werden, so dass Schreiben den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess fördert, aber es braucht eben seine Zeit. Literatur, die hilfreiche Tipps für den Schreibprozess gibt, auf die man auch Studierende verweisen kann, sind die folgenden Titel: Franck (2011), Kruse (1995), Stickel-Wolf & Wolf (2005). Außerdem bietet z. B. das Schreibcenter der TU Darmstadt aktuelle Literaturtipps.
Für den eigentlichen Schreibprozess kann es hilfreich sein, Hinweise zu geben, was Texte verständlich und gut lesbar macht und was wissenschaftlichen Stil ausmacht (u. a. Kruse 1995, Langer et al. 2011). Hier seien als Stichworte für Verständlichmacher nur folgende genannt: Einfachheit, klare Gliederung, Prägnanz und anregende Zusätze. Für den Stil: belegen statt behaupten, paraphrasieren, begründen, systematisch vorgehen und differenzieren. Ganz zentral ist die Forschungsfrage, an der entlang eine Arbeit strukturiert sein muss.
9. Abschlusspräsentation vorbereiten
In vielen Fächern ist die mündliche Präsentation der Ergebnisse ein wichtiger und teils auch notentechnisch gewichtiger Bestandteil des Abschlussarbeitsprojekts. Betreuer_innen sollten daher die Erwartungen und Bewertungskriterien dieser Präsentation transparent machen. Studierenden sollten die Gelegenheit erhalten, an den Präsentationen anderer teilzunehmen und danach auch über Stärken und Schwächen dieser Präsentationen zu sprechen. Außerdem sollte die Möglichkeit zu einem Probelauf gegeben werden. Der Probelauf kann auch von mehreren Kandidat_innen aus der Arbeitsgruppe zusammen organisiert werden, die sich dann gegenseitig Peerfeedback geben.
Was tun, wenn es unrund läuft?
Wenn die Studierenden beim Forschen und/oder Schreiben nicht vorankommen ist es zunächst essentiell zu versuchen, in einem Gespräch die Ursache von Problemen herauszufinden. Anschließend kann der/die Betreuer_in entweder selber oder mit Unterstützung von Kolleg_innen den Studierenden helfen oder an andere Stellen weiter verweisen, wie z. B. Schreibcenter oder Psychosoziale Beratungsstelle. Wenn Studierende trotz Hilfestellung nicht weiterarbeiten können, muss die Arbeit ggf. abgebrochen und/oder als nicht bestanden bewertet werden.
Ab und zu werden Betreuer_innen auch mit schwierigen Fällen konfrontiert. Ursachen für die Schwierigkeiten können wieder sehr unterschiedlicher Natur sein. Zum einen gibt es strukturelle Probleme, die der/die einzelne Betreuer_in eigentlich nicht lösen kann, dazu gehört das Betreuen internationaler Studierender, die weder Deutsch noch Englisch gut genug schreiben können, um eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit verfassen zu können. Die Lösung kann nicht sein, dass die Betreuer_innen oder andere deutsche Studierende die Arbeit für die Kandidat_innen schreiben. In solchen Fällen sollte man sehr früh offen mit den Studierenden sprechen und sie darauf hinweisen, dass sie sich zusätzliche Unterstützung holen müssen durch das Schreiblabor und/oder Übersetzer_innen beispielsweise. Hier sollten betroffene Fachbereiche sich idealerweise auch absprechen, wie sie mit solchen Fällen umgehen.
Bei Studierenden aus anderen Kulturkreisen ist es auch sinnvoll wissenschaftliche Standards beispielsweise zum Zitieren frühzeitig anzusprechen und die Studierenden gegebenenfalls in einen Kurs zum wissenschaftlichen Schreiben zu schicken, so dass sie die Standards an deutschen Universitäten kennenlernen.
Falls die Schwierigkeit nicht strukturell, sondern eher individuell bedingt ist, sollten Betreuer_innen am besten nach dem Prinzip der minimalen Intervention vorgehen. Wenn dies nicht zum Ziel führt, dann sollte ein weiteres Gespräch mit dem/der Studierenden geführt werden, bei dem eine_n Zeugen/Zeugin dabei ist. In diesem Gespräch sollte dem/der Studierenden ganz deutlich aufgezeigt werden, welche Konsequenzen drohen, wenn das Arbeitsverhalten nicht geändert wird (z. B. schlechte Note oder ein Nichtbestehen). Es sollte klare und überprüfbare Vereinbarungen über das weitere Vorgehen getroffen und schriftlich festgehalten werden. Dies ist besonders wichtig, falls es zum Rechtsfall kommen sollte. Das Flussdiagramm in Abbildung (7) fasst diese Schritte nochmal zusammen.
Tipps zum Umgang mit Jammern und Nörgeln in Beratungsgesprächen finden Sie hier. Dort gibt es auch weiterführende Literaturtipps.
Wie gehe ich mit der Bewertung um?
Lehrende sollten sich immer bewusst sein, dass eine wirklich objektive Bewertung wahrscheinlich nie möglich sein wird. Was aber möglich ist, ist eine faire und transparente Bewertung. Um dies zu erreichen braucht es zwei Grundzutaten: (a) klare, einheitliche Kriterien und (b) ein geschärftes Bewusstsein für Qualitätsstandards, was diese Kriterien letztendlich ja sind, und Übung in der Anwendung dieser Kriterien.
Zu (a): Wenn es am Fachbereich bereits einen Bewertungsbogen mit Kriterien gibt, sollten Betreuer_innen diesen nicht nur nutzen, sondern auch mit Kolleg_innen über deren Erfahrungen mit diesem Bewertungsbogen sprechen, die Stärken und Schwächen reflektieren und ggf. den Bewertungsbogen im Team überarbeiten. Falls es einen solchen Bewerbungsbogen nicht gibt, sollten Betreuer_innen unbedingt einen entwickeln, ggf. gemeinsam mit Kolleg_innen. Der Bewertungsbogen bzw. die darin enthaltenen Bewertungskritierien sollten allen Kandidat_innen zugänglich sein, dass diese wissen, anhand welcher Kriterien ihre Arbeiten bewertet werden.
Zu (b): Ein Gespür und Bewusstsein dafür, wann die Kriterien wie gut erfüllt sind, können Betreuer_innen entwickeln, indem sie Arbeiten anschauen, die andere korrigiert haben und mit Kolleg_innen über zu korrigierende Arbeiten sprechen.
Was fließt in die Bewertung ein?
Je nach Fach und Prüfungsordnung werden sich Bewertungskriterien u. U. stark unterscheiden. Folgende Bereiche könnten in die Bewertung von Abschlussarbeiten einfließen:
- Die äußere Form: Entspricht die Arbeit den formalen Vorgaben des Fachbereichs? Ist sie frei von Tipp- und Typographie-Fehlern?
- Sprache: Ist sie grammatisch richtig? Ist sie dem Fachgebiet angemessen?
- Inhalt: Gibt es eine sinnvolle Forschungsfrage? Ist die Argumentation stringent an dieser Frage ausgerichtet? Wird das eigene Vorgehen am Ende kritisch reflektiert? Werden die Ergebnisse sinnvoll diskutiert und interpretiert?
- Forschungsliteratur: Sind die relevanten Quellen genutzt? Wird die eigene Arbeit in den Forschungskontext eingeordnet? Sind die Quellen sachlich angemessen und sprachliche richtig eingearbeitet?
- Methode: Ist die Methode der Fragestellung angemessen? Wird die Methode so klar und verständlich dargestellt, dass die Studie replizierbar wäre? Werden die Daten sachlich angemessen dargestellt und präsentiert?
Neben den Kriterien muss auch deren Gewichtung durchdacht werden.
Die Korrektur der Arbeit
Der Korrektur- und Bewertungsprozess kann eine Hürde darstellen, denn selbst brillante Abschlussarbeiten brauchen Zeit, bis sie gelesen sind. Folgende Tipps können helfen, diese Hürde niedrig zu halten:
Abschlussarbeiten schnell anfangen zu lesen und dranbleiben
Erstellen und Nutzen eines verbalisierten Bewertungsrasters, das die Noten oder Prozentwerte in eine sprachliche Klassifikation übersetzt, erleichtert das Gutachtenschreiben ungemein. Beispielsweise könnte die Verortung der Arbeit im Forschungsgebiet auch bei einem sehr spezialisierten Thema sehr klar nachvollziehbar sein, was einem „sehr gut“ entspräche; wenn die Verortung aber teils unklar bleibt, wäre dies nur ein „befriedigend“.
Bei schwachen Arbeiten auch einen Blick auf die kleinen Stärken haben, die es eigentlich auch in schwächeren Arbeiten immer gibt.
Einen Gutachtenentwurf sofort nach dem Lesen schreiben, diesen Entwurf wenige Tage liegen lassen, mit Abstand nochmal lesen, korrigieren und fertig stellen.