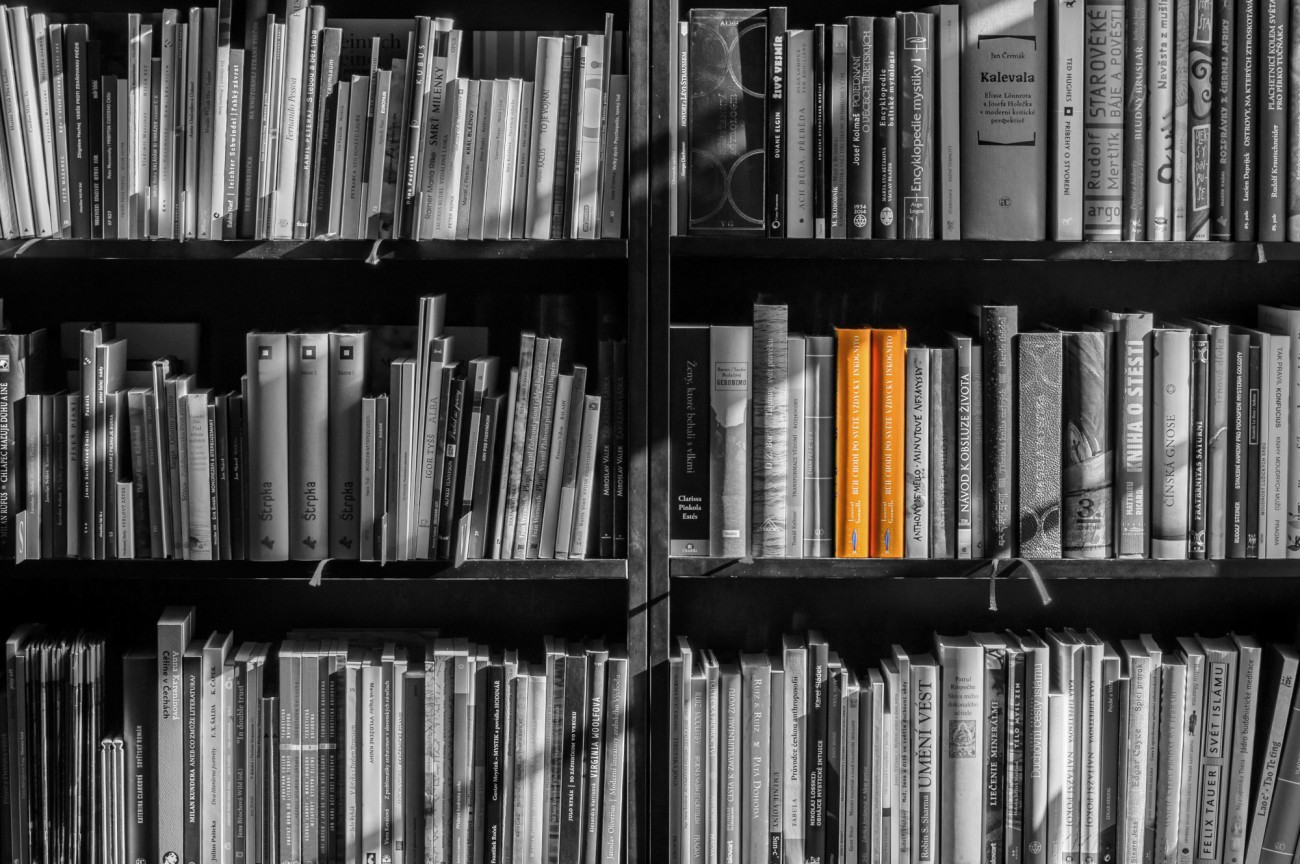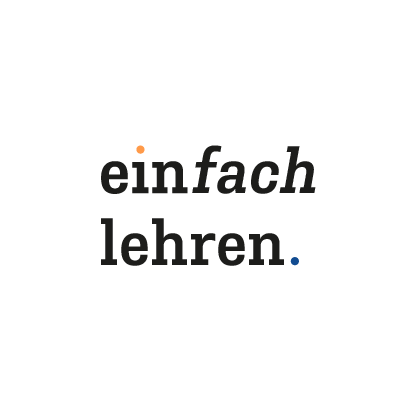Science Communication als Lernziel: Comics sind das Richtige
05.12.2024
Förderung von Medienkompetenz, Visual Literacy & Science Communication durch kreative Methoden wie die Cut-Out-Technik.
1. Worum gehts?
Der Beitrag handelt von Science Comics in der Lehre – genau genommen: von der Planung, eigenen Gestaltung und Bewertung von Science Comics durch Studierende. Er stellt ein erprobtes Lernsetting vor, in dem Studierende grundlegende Fertigkeiten, die auf Science Communication abzielen, trainieren. Das Lernsetting ist für Studierende des Lehramts ebenso geeignet wie für Fachstudierende, die sich mit Public Relations und Outreachprojekten auseinandersetzen. Im Mittelpunkt steht die Cut-Out-Technik: Flachfiguren und Objekte aus Fotokarton werden dabei auf eine Fläche gelegt, abfotografiert und digital nachbearbeitet, d. h. um Texte ergänzt und schließlich in ein Comicraster eingepasst (Prechtl 2021). Mit dieser Technik erzielen Newcomer*innen, auch ohne Zeichen-Skills, überzeugende Ergebnisse. Zudem gestattet sie, Comicfiguren, die Menschen in Forschung und Industrie repräsentieren sollen, diversitätssensibel darzustellen. Die Cut-Out-Technik ließe sich in einer langen Textpassage abhandeln, doch es geht, im Sinne des Sprichworts Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, auch kürzer: Bitte rufen Sie den folgenden Link auf: Tutorial ! Über diesen Link gelangen Sie zu einem Tutorial, das die Cut-Out-Technik auf einen Blick darlegt. Wenn Sie danach diesen Beitrag weiterlesen, sind Sie bereits im Bilde.
2. Zielgruppe
Sollten Sie nach dem Lesen der Einleitung und des Tutorials den Eindruck gewonnen haben, dass das Unterfangen zeitintensiv ist, liegen Sie richtig. Mit einer einzelnen Seminarsitzung ist es nicht getan. Für das Lernsetting der Gestaltung von Science Comics, das im Beitrag vorgestellt wird, werden Sie und die Studierenden circa 24 Stunden (50–60 % in Präsenz, zudem Selbststudium) aufwenden müssen. Erscheint Ihnen dieser Zeitaufwand zu hoch, dürften Ihnen andere Methoden bessere Unterstützung bieten. An der TU Darmstadt wird das Lernsetting, bezogen auf den Stand der Publikation dieses Beitrags, seit sieben Jahren in einem laborpraktischen Seminar (5 SWS) umgesetzt, das zu einer Hälfte klassisch-experimentell und zur anderen Hälfte auf Science-Comic-Gestaltung ausgerichtet ist.
Dieser Beitrag wurde für Dozierende geschrieben, die…
- sich Raum und Zeit nehmen können, mit Studierenden unkonventionelle Wege in der Lehre zu beschreiten.
- den Standpunkt vertreten dürfen, dass komplexe Aufgaben der Lehre guttun, weil sie Studierende vielschichtig herausfordern – angefangen beim Recherchieren und Planen, über das gemeinsame Gestalten, Reflektieren und Optimieren, bis hin zum Bewerten sowie Publizieren und Implementieren der Produkte in Public-Relations-Settings.
- die Kunst der Science Communication via Comics vermitteln möchten, weil Vieles dafürspricht (vgl. Bertemes, Haan & Hans 2024, Robin, Leblanc & Dumais 2021).
- die auf die Gestaltung eines finalen Produktes setzen möchten, dessen Erstellung zwar durch KI unterstützt, aber nicht gänzlich mit KI vollzogen werden kann.
Die mit dem Lernsetting verknüpften Lernziele, u.a. Sachwissen, Visual Literacy, Medien Handling, Social Skills, und Zeiterfordernis werden in Teil 3. Kap. 4 detailliert angeführt.
3. Basic Facts
Comics – seriously? Noch vor Jahrzehnten führte die Nähe der Begriffe Comic und Komik im Bildungswesen zu Ressentiments gegenüber Comics. Diese Zeiten sind vorbei. Sollten Sie demnächst in einen Buchladen gehen und in der Comicabteilung stöbern, werden Sie sich bewegende Geschichten erschließen können, über…
- die Adoption einer peruanischen Waise (Die Adoption, Drousie & Monin 2017),
- die Sterbepflege des geliebten Haustiers (Träume von Glück, Taniguchi 2008),
- den Justizskandal um einen Serienmörder (Haarmann, Meter & Kreitz 2010),
- die Liebe zweier Sklaven im Lichte der Religionen (Habibi, Thompson 2011),
- den ersten Libanonkrieg (Waltz with Bashir, Folman & Polonsky 2009) oder
- den Holocaust (Maus, Spiegelman 2003).
Wie Sie an den Themen sehen konnten, sind Comics nicht per se komisch. Sie lassen sich nicht darüber definieren, welche Emotionen sie bei Menschen auslösen. Aber wenn Comics nicht komisch, kindlich oder simpel sind, was charakterisiert sie dann?
3.1 Was ist ein (Science-)Comic
Mit Comics lassen sich ernsthafte, tiefgründige gesellschaftsrelevante und wissenschaftsbezogene Themen visualisieren. Das macht sie zu einem idealen Werkzeug für Science Communication (Bertemes, Haan & Hans 2024, Farinella 2018, Tribull 2018, Friesen 2018).
Bei Comics handelt es sich um Sequenzen von Einzelbildern (Panel) und anderen Zeichen, die Informationen vermitteln, und üblicherweise in einem Seitenlayout angeordnet sind, in welchem Text in Sprech- und Denkblasen, Boxen und als Onomatopoesie (Soundwords) erscheint (vgl. Jüngst 2010, 14, McCloud 2001, 17). Es gibt selbstverständlich auch Comics (Graphic Novels, Webcomics, Mangas etc.), auf die nicht alle diese Kriterien zutreffen (vgl. Packard 2016).
Der Terminus Science Comic wird im Zusammenhang mit Science Communication verwendet (Bertemes, Haan & Hans 2024). Zudem ist die Rede von Educational Comics, Non-fictional Comics, Information Comics und Sachcomics (Hangartner 2016). Im deutschsprachigen Raum ist „Sachcomic“ als Begriff gängig. Zu diesem Genre zählt Eisner (1985) Technical und Attitudinal Instruction Comics. Technical Instruction Comics bieten schrittweise Anleitungen. Ein thematisches Beispiel wäre die exakte Darstellung der Prozessschritte Ausbauen, Schreddern, in Säure lösen, Neutralisieren, Extrahieren etc. bei der Gewinnung von Edelmetallen aus verschrotteten Prozessoren. Dies kommt Erklärvideos auf YouTube nahe.
Attitudinal Instruction Comics vermitteln vorrangig eine Einstellung zu einem Thema. Ein Beispiel wäre die Empfehlung, alte Elektrogeräte beim Wertstoffhof abzugeben, um wertvolle Metalle dem Recycling zuführen zu können. Jüngst (2010) ergänzt beide Typen um Fact Comics, die weder anleiten noch persuasiv wirken möchten, sondern schlichtweg Fakten vermitteln. Um im Bild zu bleiben: Eine Comicfigur, Mitarbeiterin eines Wertstoffhofs, informiert über den Goldgehalt in Prozessoren im Kontext nachhaltiger Entwicklung. Ein Resümee für Sie:
Bei Science Comics handelt es sich um ein spezifisches Comicgenre, das auf drei wesentliche Funktionen abzielt: Informieren, Anleiten, Werte vermitteln.
3.2 Bildende Comics und Bildung durch Comics?
Der zuvor angeführte Terminus Educational Comic ist kritisch zu sehen. Nur weil Autor*innen sich wünschen, dass sie mit ihren Comics Bildung anstoßen, heißt das noch nicht, dass Resultate aufseiten der Zielgruppe eintreten müssen. Andersherum betrachtet, ist im Grunde jeder Comic lehrreich, wenn er bei Leser*innen Verständnis für Inhalte oder Werte hervorruft. Comics sind kein Universalmittel und doch entfalten sich ihre Potenziale in spezifischen Lernsettings ideal (z. B. Jaffe & Hurwich 2019, Sinha, Patel, Kim, MacCorkle & Watkins 2011, Bitz 2010, Green & Myers 2010, Griffith 2010). Lernende, die ihre eigenen fachspezifischen Fähigkeiten gering einschätzen, scheinen davon besonders zu profitieren. Sie beschäftigen sich intensiver mit einem Thema, wenn dieses nicht als Aufsatz, sondern als Comic dargeboten wird (Spiegel 2013).
3.3 Ein gemeinsamer Blick auf Wissenschaft und Comic
Sie werden es bemerkt haben: Alle Beispiele stammen aus der Chemie, was dadurch zu erklären ist, dass der Autor Chemiedidaktiker ist. Comic-Leser*innen, die die Freiräume zwischen den Panels des Comics imaginativ überbrücken, agieren wie Chemie-Fachleute, die Reaktionsmechanismen deuten: im Kopf ergänzen sie Zwischenschritte, Dreidimensionalität und Dynamik (Hoffmann & Laszlo 1991). Weitere Gemeinsamkeiten können Sie sich beim parallelen Lesen von McClouds Buch Comic richtig lesen (2001) und Rheinbergers Aufsatz über Visualisierungen in den Naturwissenschaften (2009) erschließen:
- Kompression und Dilatation von Raum und Zeit: Sind Objekte oder Phänomene zu klein, werden sie vergrößert, sind sie zu groß, verkleinert. Was für unsere Sinne zu schnell ist, wird ausgebremst, was zu langsam ist, wird beschleunigt.
- Verstärkung und Schematisierung: Mit Codes wie Kontur, Proportion, Hinweispfeil oder Symbolfarbe wird die Typik eines Objektes herausgearbeitet. Exemplarisch sei auf Kontraste verwiesen, die Details und Strukturen wahrnehmbar machen (in der Biochemie: Fluoreszenzmarkierung, im Comic: Strichstärken beim Inking).
Bedenken Sie auch: Manch ein Symbol, z.B. aus dem Bereich der chemischen Moleküle, wird mit Alltagsgegenständen assoziiert. Fullerene sehen aus wie Fußbälle und Chaperone erinnern an einen Topf mit Deckel. „Die Welt der Moleküle gewinnt durch diese konnotative Integration den Charakter einer miniaturisierten Alltagswelt“ (Schummer 1995). Das nennt man Transmediation.
3.4 Ein Trip durch die Chemie? – Über die Vorzüge des Storytellings
Der chemiehistorische Comic Bicycle Day (Blomerth 2019) spitzt die Ereignisse des 19. April 1943 zu, nachdem Albert Hofmann, im Selbstexperiment, eine hohe Dosis der neu synthetisierten Substanz Lysergsäurediethylamid (LSD) zu sich genommen hatte. Im Technicolor-Comix-Stil umgesetzt, bietet er alles, was Chemie ausmacht: opulente Versuchsapparaturen und Laborkabinetts, Fachsprache und Symbolik, Kooperationen und Dispute – sowie Ekstase. In reicher Bildsprache lässt der Comic Menschen am situativen Erleben des Chemikers teilhaben und regt die Imagination aller an, die noch nie LSD synthetisiert und keine Vorerfahrung mit Drogen gemacht haben. (Visuelles) Storytelling erlaubt Begegnungen mit Menschen an fremden Orten in der Vergangenheit oder Zukunft, den Blick über deren Schulter auf Handgriffe und Karten, das Einfühlen in Konflikte etc. (Prechtl & Legscha 2022, Kellermann 2018). Alles fängt mit der Narration an. Sie wird als Storyboard eingerichtet. Mit diesem wird die visuelle Umsetzung des Comics realisiert.
Autor:in
Dr. Markus Prechtl, TU Darmstadt. Aktuell Professor für Fachdidaktik Chemie, Arbeitsschwerpunkte: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gender/Diversity, (Visual) Science Communication